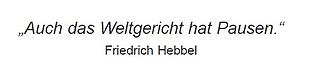Musils Kakanien#
Eine Interpretation aus staatsphilosophischer Sicht – mit kritischen Bemerkungen zur aktuellen Politikvon Andreas Stupka
Die Österreichisch-Ungarische Monarchie war ein Staat in
Zentraleuropa mit einer Gesamtfläche von rund 676.000
Quadratkilometern und einer Bevölkerungszahl am Beginn
des Ersten Weltkrieges von rund 53 Millionen Menschen[1];
in diesem Staatsgebilde lebten zahlreiche Völkerschaften,
unter denen die Deutschen, die Magyaren und die Slawen
die stärksten Volksgruppen waren. Dieser Vielvölkerstaat war
1918 zusammen mit seinem Kaiser und König untergegangen.
Eine Reihe namhafter zeitgenössischer Schriftsteller,
wie beispielsweise Franz Theodor Czokor, hat sich mit dem
Untergang der Monarchie befasst, vor allem auch mit der dem
Krieg vorangegangenen Epoche.
Mit Trübsal belegt berichten sie meist über jenes Gemeinwesen, das Joseph Roth in seiner Kapuzinergruft als „unser Reich, etwas Größeres, Weiteres, Erhabeneres als nur ein Vaterland“ bezeichnete. Für viele war diese Katastrophe kaum erträglich, eine nicht geringe Zahl ist daran zerbrochen. Stefan Zweig zeichnet in der Welt von gestern wunderbare Bilder der alten Monarchie. Sie lassen diese Zeit des Kaisers in einem wärmeren Licht erstrahlen, als das republikanische Danach dies zugeben konnte, um nur ja nicht wieder zurückzufallen in jene Epoche, die den neuen Herren im Lande nun als verabscheuungswürdig zu gelten hatte.
Musil war also nicht allein in seinem Streben, der alten Monarchie zu huldigen und sie hinaufzuheben als den „fortschrittlichsten Staat“. Es war das Zeitalter seiner Jugend gewesen und er war für seinen Kaiser und König in den Krieg gezogen, als Reservist zu den Waffen geeilt für sein geliebtes Kakanien. Er war somit ein Teil der k. k. Landwehr, die zusammen mit den Truppen der k. u. k. Armee an der italienischen Front stand. Diese Bezeichnungen folgten zwar einer stringenten Logik, die den gesamten Staatsapparat umfasste, für den einzelnen Bürger und für die ausländischen Geheimdienste war diese Logik jedoch nur schwer nachvollziehbar, wie Musil zugibt:
Es war zum Beispiel kaiserlich-königlich und war kaiserlich und königlich; eines der beiden Zeichen k. k. oder k. u. k. trug dort jede Sache und Person, aber es bedurfte trotzdem einer Geheimwissenschaft, um immer sicher unterscheiden zu können, welche Einrichtungen und Menschen k. k. und welche k. u. k. zu rufen waren.
Wenn nun Musils Kakanien zur Sprache gebracht werden soll, dann nicht, um die alte Geschichte erneut aufzurollen, oder gar die Absicht zu verfolgen, das Wesen der Donaumonarchie in ein neues Licht zu rücken. Zu diesem Thema füllen bereits Bände Bibliotheken. Vielmehr soll es sich hier um den Staat im Allgemeinen drehen, denn dieses schmale achte Kapitelchen aus dem Mann ohne Eigenschaften hat viel bemerkenswert Staatstheoretisches an sich, das aufzufalten sich lohnt. Da der Staat an sich nur ein hohler Torso der allgemeinen Ordnung ist, gehören auch die Menschen dazu – bewusst im Plural gefasst – als Gesellschaft. Und so birgt dieser kurze Text soziologische Erkenntnisse, die sich jedoch sofort und unvermittelt auf den Staat und dessen Gefüge auswirken. Musil blickt mit einem Abstand von 20 Jahren zurück, wobei die Aufgabe der Dichter es ist, mit ihrer Erzähl- und Ausdrucksweise die Dinge auf den Punkt zu bringen. Vor allem auch politische Angelegenheiten, und mit diesem Streifzug durch Kakanien, so interpretiere ich das, hat Musil seine Vorstellungen eines funktionierenden Staates auf brillante Weise kundgetan. Also gehen wir in medias res.
Ein Konzept gegen den Wachstums-Wahn#
Immer größer, höher, weiter ist das erstrebenswerte Ziel unserer Zeit. Es gilt ein ständiges Wachstum zu erzeugen und beizubehalten, das ist die Doktrin, von der keinen Millimeter abgewichen werden darf. Daher sprechen wir von Nullwachstum, wenn die Bezeichnung Stillstand angebracht wäre, ja sogar von Minuswachstum, wenn das Wachsen einmal rückläufig ist und Verluste geschrieben werden. Das ganze Leben der zivilisiertenMenschen ist auf dieses Dogma hin ausgerichtet, denn dieses ständige Wachsen, Anhäufen, Zugewinnen, Heranraffen scheint der wahre Weg zum Glücklichsein. Dass die Menschen im Sog der Gewinnmaximierung ihr Glück auch tatsächlich finden, darf angezweifelt werden. Musil geht von einem Ist-Zustand aus, der sich in unseren Tagen des Neoliberalismus ähnlich bis zur Unerträglichkeit gesteigert hat, wie damals Ende der 1920er Jahre:
Eine solche soziale Zwangsvorstellung ist nun schon seit langem eine Art überamerikanische Stadt, wo alles mit der Stoppuhr in der Hand eilt oder stillsteht. Luft und Erde bilden einen Ameisenbau, von den Stockwerken der Verkehrsstraßen durchzogen. ... Fragen und Antworten klinken ineinander wie Maschinenglieder, jeder Mensch hat nur ganz bestimmte Aufgaben, die Berufe sind an bestimmten Orten in Gruppen zusammengezogen, man ißt während der Bewegung, die Vergnügungen sind in andern Stadtteilen zusammengezogen, und wieder anderswo stehen die Türme, wo man Frau, Familie, Grammophon und Seele findet. Spannung und Abspannung, Tätigkeit und Liebe werden zeitlich genau getrennt und nach gründlicher Laboratoriumserfahrung ausgewogen. [...] Die Ziele sind kurz gesteckt; aber auch das Leben ist kurz, man gewinnt ihm so ein Maximum des Erreichens ab, und mehr braucht der Mensch nicht zu seinem Glück, denn was man erreicht, formt die Seele, während das, was man ohne Erfüllung will, sie nur verbiegt; für das Glück kommt es sehr wenig auf das an, was man will, sondern nur darauf, dass man es erreicht.
Dies betrifft natürlich auch den dazugehörigen Staat. Auch er ist von der Idee des permanenten Wachstums durchwirkt und beseelt. Das muss auch so sein, sind es doch gerade die so beseelten Menschen, die den Staat formen. Es spießt sich lediglich an der Funktionalität des Gemeinwesens. Nach Gewinnmaximierung strebende Utilitaristen kennen nur ihr eigenes Ziel, sie sind Egoisten, jeder auf seine Weise. Das ganze Spektrum handelt so – dazu zwei Extreme: Erstens: Der Vermögen anhäufende Bankmanager bekommt noch immer Bonus-Zahlungen, obwohl er sein Geldinstitut gerade gerade in die Pleite gestürzt hat. Zweitens: Der Schwarzarbeiter bezieht ein zweites Gehalt über das Arbeitslosengeld. Die Sozialausgaben steigen ins Unermessliche. Ein Heer an Greisen muss versorgt werden, Kinder kommen zu wenige nach. Und viele unter diesen wenigen sind nicht leistungswillig, sie wollen ebenso bloß versorgt werden. Der Staat kracht und ächzt, er erkennt Versäumnisse – und er handelt: Er erhöht die Steuern und presst denjenigen, die noch nicht staatlich versorgt werden, den Saft aus, bis an die Schmerzgrenze. Das Wichtigste sei der Erhalt des so genannten sozialen Friedens. Er bestraft Sexualverbrechen mit Fußfesseln und Vermögensdelikte mit Gefängnisstrafen. Der oberste Gott bleibt also doch das Geld, die Doktrin zur Gewinnmaximierung ist das dazu veranstaltete Requiem. Aber die Minen sind schon gegraben, die Gesellschaft ist bereits ausgehöhlt. Sie werden gerade mit Pulver gefüllt, der soziale Frieden ist ein trügerischer. Der Zug der Zeit rast Veränderungen entgegen und es bedarf nur eines Funkens, das Pulver zu zünden. Springt eine Mine, gehen die anderen mit, ein Dominoeffekt. Diesen gefährlichen Zug hat Musil vor Augen in der aufgeladenen Zeit zwischen den Kriegen:
[...] es kommt vor, wenn man nach längerer Pause hinaussieht, daß sich die Landschaft geändert hat; was da vorbeifliegt, fliegt vorbei, weil es nicht anders sein kann, aber bei aller Ergebenheit gewinnt ein unangenehmes Gefühl immer mehr Gewalt, als ob man über das Ziel hinausgefahren oder auf eine falsche Strecke geraten wäre. Und eines Tages ist das stürmische Bedürfnis da: Aussteigen! Abspringen! Ein Heimweh nach Aufgehalten werden, Nichtsichentwickeln, Steckenbleiben, Zurückkehren zu einem Punkt, der vor der falschen Abzweigung liegt!
Weg, bevor die Mine springt! Politikverdrossenheit nennen wir dies heute, denn die vermeintliche Aufgabe der Politik wäre es ja zurückzuführen, was sich im Zuge der Zeit auf Irrwegen verlaufen hat. Ein Trugschluss! Es sind dieselben Menschen, die die Politik bestimmen und den Gewinn zu maximieren suchen: die ganz oben über ihre Einflüsse, die ganz unten über ihre Vielzahl. Der Politiker ist genötigt, sich nach dem Zeitgeist zu orientieren – alle paar Jahre zu den Wahlen eben, sonst war er die längste Zeit Politiker. Politik und Gesellschaft haben sich gleichermaßen auf diese Odyssee des permanenten Wachstums begeben. Viele meinen, dass dieser Zug einem Abgrund entgegenrast, sie meinen aber auch, dass die Politik nicht mehr fähig ist, den Zug anzuhalten. In ihrer Verzweiflung erwählen sie sich neue Führer, die mit Gaukelei und Demagogie mehr am Hut haben denn mit der Politik.
Eine gewisse Sehnsucht nach Heimat liegt heute im Gemüt, und um 1930, als Musil dies veröffentlichte, dürfte es ähnlich gewesen sein, bereits damals hatten Gaukler und Demagogen Hochkonjunktur. Er besinnt sich auf längst vergangene Tage und zeigt notwendige Wertmaßstäbe für das politische Gelingen eines Gemeinwesens auf:Und in der guten alten Zeit, als es das Kaisertum Österreich noch gab, konnte man in einem solchen Falle den Zug der Zeit verlassen, sich in einen gewöhnlichen Zug einer gewöhnlichen Eisenbahn setzen und in die Heimat zurückfahren. Dort, in Kakanien, diesem seither untergegangenen, unverstandenen Staat, der in so vielem ohne Anerkennung vorbildlich gewesen ist, gab es auch Tempo, aber nicht zuviel Tempo.
Heute geben wir Vollgas. Veränderung um jeden Preis, lautet die Devise. Alles muss reformiert werden, um der Gewinnmaximierung entsprechend zu huldigen. Die Politik plant nur kurzfristig, nach Gesetzgebungsperioden. Anpassen durch Veränderung, dem Volk aufs Maul schauen, den Zeitgeist mittragen, um am Futtertrog bleiben zu können. Werte werden zu Worthülsen. In Kakanien mochte es das durchaus auch gegeben haben, nur nicht zur Maxime erhoben. Dafür stand der Kaiser. Nicht nur als Institution, sondern auch in Fleisch und Blut. Das 70-jährige Regierungsjubiläum ist die Rahmenhandlung von Musils Roman. Franz Joseph regierte 68 Jahre und führte das Land von einer absoluten Herrschaft in eine parlamentarische Monarchie. Maßvolle Anpassung, unter Zugrundelegung von Werten, wie sie im Staatsgrundgesetz von 1867 niedergelegt wurden – dies vermittelt jene Kontinuität und Beständigkeit, die das Symbol des Kaisers verkörpert. Kontinuität in den Werthaltungen gleicht einer Richtschnur, woran sich Politik und Bürger gleichermaßen zu orientieren vermögen. Sie ist daher erste wesentliche Grundlage für die gedeihliche Entwicklung des Gemeinwesens.
Musil geht aber hier noch weiter, denn die Kontinuität alleine wäre zum Gelingen des Staatsganzen zu wenig:
Natürlich rollten auf diesen Straßen auch Automobile; aber nicht zuviel Automobile! Man bereitete die Eroberung der Luft vor, auch hier; aber nicht zu intensiv. Man ließ hie und da ein Schiff nach Südamerika oder Ostasien fahren; aber nicht zu oft. Man hatte keinen Weltwirtschafts- und Weltmachtehrgeiz; man saß im Mittelpunkt Europas, wo die alten Weltachsen sich schneiden; die Worte Kolonie und Übersee hörte man an wie etwas noch gänzlich Unerprobtes und Fernes.
Besonnen dem Zeitgeist widerstehen#
In diesem Handeln tritt jene Eigenschaft zu Tage, derer es zur guten Führung des Gemeinwesens bedarf: die Besonnenheit. Nicht dabei sein, um dessen selbst willen. Wir tendieren heute dazu, uns dem vorherrschenden Zeitgeist nur allzu schnell anzupassen, damit wir nichts verpassen, wie wir meinen. Dies drückt sich vor allem in der immer öfter gepflogenen Anlassgesetzgebung aus. Auch der sogenannte Lobbyismus fällt in diese Kategorie, wo man entweder aus einer übertriebenen Hektik heraus oder aus purem Gewinnstreben agiert. Das Staatsganze leidet in der Regel darunter. Gesetze müssen dann wieder korrigiert werden, oder es bedarf neuer Gesetze, um die einmal getroffene schlechte Entscheidung wieder zu relativieren.Es ging nicht alles so schnell in Kakanien, es war auch nicht immer alles gut, das will Musil nicht sagen, aber das politische System praktizierte jene notwendige Besonnenheit in der Gesetzgebung, die uns heute zum Vorbild gereichen kann. Die Rolle des Politikers selbst wäre zu hinterfragen! Und es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass nicht jeder für alles verwendet werden darf. In der heutigen politischen Landschaft wird einer oder eine schnell einmal Minister für dies oder jenes. Und ebenso schnell wird das Ressort dann wieder gewechselt, weil es sich besser ins koalitionäre Bild einfügt. Der Minister selbst, oft ein Berufspolitiker, aber oft ohne politische Bildung, hat sich hochgedient über die Partei, denn Politik, so meint man, kann jeder machen. Grundsätzlich stimmt das, aber es wird die Ebene vergessen, es kann eben nicht jeder überall Politik machen. Er wird so seiner Bestimmung, dem Dienen, nicht gerecht, er kann dem gar nicht gerecht werden, weil er um das Dienen mangels Bildung nicht weiß. Es bedarf also auch der Besonnenheit in der Besetzung aller politischen Ämter, dies wäre an die politischen Parteien gerichtet. Auch daher rührt ein Teil dieser schon angesprochenen Politikverdrossenheit in der Bevölkerung, sie gründet sich auf das mangelnde Vertrauen in die handelnden Personen. Diese Besonnenheit, die Musil einfordert, scheinen die gegenwärtigen Zugführer verlernt zu haben.
Verwaltungsreform: Gestrüpp statt Rosen#
Ganz eng damit verknüpft ist die staatliche Ordnung, über die Musil schreibt:Und verwaltet wurde dieses Land in einer aufgeklärten, wenig fühlbaren, alle Spitzen vorsichtig beschneidenden Weise von der besten Bürokratie Europas, der man nur einen Fehler nachsagen konnte: Sie empfand Genie und geniale Unternehmungssucht an Privatpersonen, die nicht durch hohe Geburt oder einen Staatsauftrag dazu privilegiert waren, als vorlautes Benehmen und Anmaßung. Aber wer ließe sich gerne von Unbefugten dreinreden! Und in Kakanien wurde überdies immer nur ein Genie für einen Lümmel gehalten, aber niemals, wie es anderswo vorkam, schon der Lümmel für ein Genie.
Vielen Bürgern ist heute nicht mehr bewusst, dass es für das Funktionieren eines Gemeinwesens einer Schar an sehr gut ausgebildeten Beamten bedarf. Die integren, treuen Beamten sind die Träger des Staatsganzen. Je weniger wert die Beamten sind, desto weniger wert ist der Staat; Korruption, Faulheit, Privilegienritterschaft und alle diese negativen Attribute schleichen sich ein, der funktionierende, verlässliche Staat mutiert über einen gewissen Zeitraum hin zur Bananenrepublik. Das hat nicht nur eine Ursache, sondern derer viele, die sich gegenseitig bedingen. Im heutigen Österreich fängt es ganz oben an: Je mehr Gesetze erlassen werden, desto mehr Beamte braucht es, um diese zu vollziehen und zu kontrollieren, ansonsten sind sie wirkungslos. Die erwähnte Anlassgesetzgebung verschärft diesen Trend zur totalen Verrechtlichung allen Seins, sodass kaum mehr ein Überblick gewahrt werden kann. Dies begründet zu einem Gutteil die Vielzahl an Beamten. Die Legislative legt falsche Geleise, auf denen unser Zug dahindonnert.
Beamte haben dem Staat zu dienen und die Ordnung zu wahren. Daraus erwächst immer eine gewisse Kluft zwischen den Staatsdienern und der restlichen Bevölkerung. Es umweht sie ein Hauch von Herrschaft, der zum neoliberalen Egoismus nicht passt. Beamtentum sei fortschrittsfeindlich, nach Leistung solle gerichtet werden. Pragmatisierung und Biennalsprünge werden zu Relikten überholter Epochen. Die Beamten gelten als privilegiert, nicht besonders arbeitsam und überbezahlt. Das mag schon für Teilbereiche so seine Richtigkeit haben, aber trotzdem funktioniert Staat ohne herrschaftliche Ordnung nicht – zumindest nicht zum Wohle aller. Das österreichische Beamtentum hat sich über die Zeit verwachsen, Wildwuchs ist aufgekeimt zwischen den Rosen Kakaniens. Die Politik ist aufgefordert zur Heckenschere zu greifen. Der Zeitgeist tendiert jedoch dazu, das Gestrüpp stehen zu lassen und die Rosen herauszuschneiden – Gleichheit ist hierzu das Leitwort. Gestrüpp ist Anarchie, Willkür und Recht des Stärkeren: Politik ist daher nicht Beliebigkeit des Zeitgeistes, sondern sie trägt Verantwortung für das Gemeinwesen.
Der gute Staat ist ein gepflegter Garten, alles hat seinen Platz, die Ordnung ist im Gleichgewicht, Neues wird erlaubt. Nichts jedoch überwuchert, Schrilles wird vermieden, Besonderes akzentuiert gesetzt, immer mit dem gehörigen Maß an Zurückhaltung, um das Gesamtbild nicht zu stören. Kakanien war sich seiner Stellung in der Welt bewusst und überzog daher die Geflechte nicht, Musil hebt hiermit die Mäßigung hervor:
Man entfaltete Luxus; aber beileibe nicht so überfeinert wie die Franzosen. Man trieb Sport; aber nicht so närrisch wie die Angelsachsen. Auch die Hauptstadt war um einiges kleiner als alle andern größten Städte der Welt, aber doch um ein Erkleckliches größer, als es bloß Großstädte sind.
Erster sein zu wollen, bedeutet vorne sein zu müssen. Die Angst vor dem Zurückbleiben treibt den Ersten weiter. Sie treibt den Staat immer in den Krieg. Alle Ersten haben letztendlich immer Krieg geführt, um sich als Erster zu behaupten – bis sie nicht mehr konnten und das Zepter des Weltgeistes an einen anderen übergeben mussten. So erging es den Makedoniern unter Alexander, den Römern zuerst im Westen, dann tausend Jahre später im Osten, den Spaniern, den Osmanen, den Franzosen unter Ludwig XIV. und Napoleon und so fort bis in unsere Tage, den Blick auf Afghanistan gerichtet.
Kakanien war zwar eine Großmacht, wollte aber nie Erster sein[2]. Ins Bild gerückt wird damit das Maßhalten, wie bereits Platon es nennt und die Mäßigung damit zur obersten seiner Kardinaltugenden erhebt. Neoliberalismus, politischer Fanatismus und alle anderen Ismen, die in unseren Tagen auf den Thron gehoben werden, vertragen sich mit dieser Idee genauso wenig wie übertriebene Toleranz, penetrant geheuchelte Interkulturalität, Quotenregelung und sonstiger Müll des Zeitgeistes. Unmäßigkeit verheißt kein Glücklichsein, denn ohne Zufriedenheit ist es nicht erreichbar. Da diese Tugend beim Individuum beginnt, bei seiner Erziehung, seinem Aufwachsen, dreht sich hier alles um die Prägung, die eben jenes Individuum erfährt. Es ist der Staat, der durch maßvolles politisches Handeln die Prägung der Menschen bestimmt, er hat somit sein eigenes Schicksal in der Hand. Musil unterstreicht die staatliche Mäßigung über die Aufwendungen für das Militär: „Man gab Unsummen für das Heer aus; aber doch nur gerade so viel, dass man sicher die zweitschwächste der Großmächte blieb.“Keine Eroberungskriege waren geplant und keine Kolonialkriege, keine Allüren als Weltpolizist, aber dennoch jederzeit bereit das eigene Land und das eigene Volk zu schützen vor solchen Ansinnen anderer. Vor allem aber geht es um die Wehrhaftigkeit aller, die mit dem System der allgemeinen Wehrpflicht jenen Willen verkörpert, der das gesamte Staatsvolk bereit sein lässt, seine Werte, seine Kultur und damit sich selbst als Menschen verteidigen zu wollen. Jeder einzelne als Bürger eben dieses Staates ist es, dem es um denSelbsterhalt geht, der aber sonst in Frieden mit allen anderen Völkern leben möchte. Hier haben die österreichischen Bürger Besonnenheit gezeigt, als sie sich am 20. Jänner 2013 für die Beibehaltung des Systems der allgemeinen Wehrpflicht entschieden haben – sie haben dem Zeitgeist und der Boulevard- Presse, die so gern in Anlehnung an die Gewaltenteilung Montesquieus als die vierte Macht bezeichnet wird, die Stirn geboten. Die Informationen im Vorfeld zu dieser Volksbefragung waren bescheiden gewesen und in den meisten Fällen keinesfalls sachlich, sondern geprägt von Polemiken und Untergriffen. Dennoch war hier ein Gefühl vorhanden in den Bürgern, dass es falsch sei, die allgemeine Wehrhaftigkeit aufzugeben. Möglicherweise ist es der maßvolle Geist Kakaniens gewesen.
Der „Weg dazwischen“ als Erfolgsrezept#
Musil skizziert diesen merkwürdigen Geist in einer seltsam anmutenden Dialektik, deren Synthesis über einen langen Zeitraum hinweg den Zusammenhalt ermöglichte. Es bestand also eine verborgene, eine dunkle Ordnung in Kakanien, die hinter der Staatsordnung stand und diese unsichtbar anleitete und führte:Es nannte sich schriftlich Österreichisch-Ungarische Monarchie und ließ sich mündlich Österreich rufen; mit einem Namen also, den es mit feierlichem Staatsschwur abgelegt hatte, aber in allen Gefühlsangelegenheiten beibehielt, zum Zeichen, dass Gefühle ebenso wichtig sind wie Staatsrecht, und Vorschriften nicht den wirklichen Lebensernst bedeuten. Es war nach seiner Verfassung liberal, aber es wurde klerikal regiert. Es wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig. Vor dem Gesetz waren alle Bürger gleich, aber nicht alle waren eben Bürger. Man hatte ein Parlament, welches so gewaltigen Gebrauch von seiner Freiheit machte, dass man es gewöhnlich geschlossen hielt; aber man hatte auch einen Notstandsparagraphen, mit dessen Hilfe man ohne das Parlament auskam, und jedesmal, wenn alles sich schon über den Absolutismus freute, ordnete die Krone an, dass nun doch wieder parlamentarisch regiert werden müsse. Solcher Geschehnisse gab es viele in diesem Staat [...]
Der alte Kaiser und König firmierte als apostolische Majestät, aber er schuf ein Staatsgrundgesetz, das in seinem 14. Artikel jedem Einwohner Kakaniens die Freiheit der Religionsausübung gestattet – soweit er sich an die Gesetze hält und nichts anstrebt, das anderen Glaubensgemeinschaften oder gar dem Staat Schaden zufügen könnte. Diesen Weg dazwischen kennen wir nur aus Kakanien, überall anders gilt Schwarz oder Weiß, entweder strenger Laizismus oder eine Staatsreligion. Die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei, wurde in Kakanien proklamiert. Damit sich dies nicht zu einem Sophismus auswuchs, wie wir ihn heute kennen, achtete man in den Lehrplänen der Schulen sehr genau darauf, was unterrichtet werden sollte. Bildungspolitik bedarf der sorgfältigen Auswahl von Bildungsinhalten; sie sollte sich nicht durch den Zuruf wissenschaftlichen Zeitgeistes aus einer Sackgasse leiten lassen. In Kakanien liefen die Uhren zwar langsamer, aber dafür mit Bedacht. Und eben dies ist Musils Antrieb, diesen versunkenen Staat über alle anderen hinauszuheben: „Soweit das nun überhaupt allen Augen sichtbar werden kann, war es in Kakanien geschehen, und darin war Kakanien, ohne dass die Welt es schon wusste, der fortgeschrittenste Staat; [...]“
Kakanien war Musils Metapher für ein Ideal, den wahren Staat. Kakanien war unvollkommen, zwiespältig, langsam. Musil hatte erkannt, dass der ideale Staat nicht perfekt sein kann, es nicht darauf ankommt Erster zu sein. Das Genie kennzeichnet nicht das Voranpeitschen des Fortschritts. Der wahre Staat wirkt durch Kontinuität, Besonnenheit, Ordnung und Mäßigung. Damit erreicht er das höchste Glück für den Bürger – für alle Bürger, er ist auf diese Weise genial, wie Musil dies resümiert: „Ja, es war, trotz vielem, was dagegen spricht, Kakanien vielleicht doch ein Land für Genies; und wahrscheinlich ist es daran auch zugrunde gegangen.“
[1]Zum Vergleich: lt. Eurostat leben dzt. in Deutschland 82 Mio Einwohner auf 357.000 km2, in Frankreich 66 Mio auf 549.000 km2 und in der Türkei 75 Mio auf 784.000 km2.
[2] Kakanien war nie Erster und wollte auch keinen Krieg. Und dennoch hat der Erste Weltkrieg hier in diesem Kakanien seinen Ausgang genommen. Aber wahrscheinlich gerade deswegen, denn die Großmacht sah sich durch einen Zwerg herausgefordert, die Ermordung des Thronfolgers musste in irgendeiner Weise gesühnt werden. Der Kaiser zögerte lange, stellte ein Ultimatum an Serbien, letztendlich setzen sich die Bellizisten durch – Kriegserklärung. Eine Strafexpedition war geplant, mit einem raschen Feldzug sollte Serbien zur Räson gebracht werden. Die Völker der Monarchie taumelten in den Krieg, aus Pflichtgefühl gegenüber dem alten Kaiser, der diese Ungeheuerlichkeit nicht hinnehmen konnte, und aus einer gewissen Verklärtheit heraus. In seiner Welt von gestern äußert sich Stefan Zweig dazu als Zeitzeuge: „Und dann, was wussten 1914, nach fast einem halben Jahrhundert des Friedens, die großen Massen vom Kriege? Sie kannten ihn nicht, sie hatten kaum je an ihn gedacht. Er war eine Legende, und gerade die Ferne hatte ihn heroisch und romantisch gemacht. Sie sahen ihn immer noch aus der Perspektive der Schullesebücher und der Bilder in den Galerien: blendende Reiterattacken in blitzblanken Uniformen, der tödliche Schuss jeweils großmütig mitten durchs Herz, der ganze Feldzug, ein schmetternder Siegesmarsch – ‚Weihnachten sind wir wieder zu Hause‘, riefen im August 1914 die Rekruten lachend den Müttern zu.“ Niemand vermochte zu diesem Zeitpunkt erkennen, welches Grauen heraufbeschworen wurde, das letztendlich vier Jahre dauern sollte und Kakanien zerriss.
Dieser Beitrag ist der Vorabdruck eines Vortrags, den DDr. Stupka im Rahmen der von der Plattform Bibliotheksinitiativen mitorganisierten Tagung „Robert Musil: Der Mann mit Eigenschaften“ am 24.4.2013 hielt und der in den von den Bibliotheksinitiativen geplanten Tagungsband aufgenommen werden wird. Wir danken dem Autor und den Veranstaltern für die Abdruckgenehmigung!
Oberst des Generalstabsdienstes MMag. DDr. Andreas W. Stupka, geb. 1963 in St. Pölten, erwarb seine militärische Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, an der Landesverteidigungsakademie in Wien und an der Führungsakademie der deutschen Bundeswehr in Hamburg und studierte an der Universität Wien Politikwissenschaften und Philosophie. Promotion im Bereich Politikwissenschaften 2002, im Bereich Philosophie 2010. Er bekleidete die unterschiedlichsten Führungspositionen im Österreichischen Bundesheer, war Lehrer für Taktik und Sicherheitspolitik an der Landesverteidigungsakademie, Chefredakteur der Österreichischen militärischen Zeitschrift, Chef des Stabes der United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) in Syrien/Israel und Chef Planung und Entwicklung im Hauptquartier KFOR im Kosovo sowie in beiden Einsätzen Kommandant des österreichischen Kontingentes. Seit 2008 ist Andreas Stupka Leiter des Instituts für Human- und Sozialwissenschaften an der Landesverteidigungsakademie in Wien.
![]() Robert Musil (Biographie)
Robert Musil (Biographie)