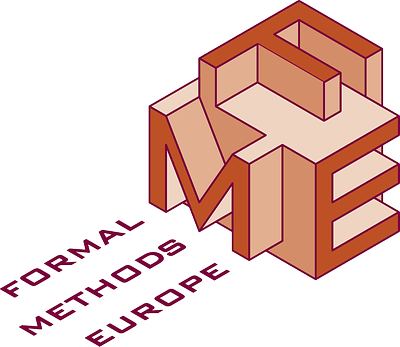Aufbruchsstimmungen#
Von Kurt Walk, August 2017 Mein Studium der technischen Physik an der TH Wien habe ich 1950 begonnen. Die Disziplinen, die später für mich wichtig werden sollten, waren damals im Studienplan noch nicht enthalten. Es waren dies die Halbleiterphysik und die Informatik, deren Bezeichnung als solche damals noch gar nicht gebräuchlich war.Beides gab es aber in ersten Ansätzen am Institut für Niederfrequenztechnik, betreut vom damaligen Assistenten Dr. Heinz Zemanek.
Es gab dort auch Transistoren, allerdings nur ganz wenige. Ich erinnere mich noch an eine spaßig an die Wand geheftete “Todesanzeige”, die das Ableben des “geliebten fünf-vorletzten Transistors” des Instituts beklagte. Meine Diplomarbeit wollte ich jedenfalls an diesem Institut machen. Ich begann damit 1954 mit einem Thema aus der digitalen Schaltungstechnik mit Transistoren. Den Bereich der digitalen Technik betrachtete ich zunächst fast als trivial, verglichen mit der Verwendung von Transistoren als analoge Verstärker. Welch ein Irrtum!
Heinz Zemanek hatte zu dieser Zeit bereits die Idee, am Institut einen Computer zu bauen. Es gab damals schon an einigen europäischen Universitäten Computerprojekte. Allerdings hat man dort mit Elektronenröhren, nicht mit Transistoren gebaut.
Die Verwendung von Transistoren, aus der Halbleiterphysik entwickelt, versprach aber entscheidende Vorteile gegenüber den Röhren in Bezug auf Platzbedarf, Energieverbrauch und Zuverlässigkeit. Sie waren damals allerdings langsamer als Röhren, und vor allem fehlte die schaltungstechnische Erfahrung. Es gab also Probleme zu lösen, eine gute Voraussetzung für den Beginn eines Hochschulprojekts mit Transistoren.
Es gelang Zemanek Geld- und Sachspenden für das Computerprojekt zu organisieren. Er hat damals auch provisorisch die Leitung des Instituts übernommen, der leitende Professor war nach Amerika gegangen, seine Position noch nicht neu besetzt worden.
Zemanek hat dadurch Freiheiten gewonnen, die er nützte. So konnte das Projekt zum Bau eines transistorbasierten Computers beginnen, der dann unter dem Namen “Mailüfterl” bekannt wurde.
Der Name war eine humorige Anspielung auf andere europäische oder amerikanische Computerprojekte, die ihre Produkte etwa “Whirlwind” oder “Typhoon” nannten.

Im Wiener Projekt arbeitete ein Team von Diplomanden, Studenten der Elektrotechnik oder, in meinem Fall, der Technischen Physik, unter der Leitung von Zemanek. Es waren für mich Arbeitsjahre, die ich nicht missen möchte. Es herrschten Teamgeist und Aufbruchsstimmung. Es gab keine geregelten Arbeitszeiten, es wurde getan, was notwendig war. Auch gelegentlich in der Nacht, wenn wir zum Beispiel für das Aufzeichnen der Synchronspur auf den Trommelspeicher ein möglichst stabiles Stromnetz brauchten. Diese Erfahrung hat mich geprägt. Etwa die strikte Trennung von Arbeitszeit und Freizeit ist mir bis heute fremd geblieben.
Die Mitglieder des Teams waren für jeweils einen Hauptbereich verantwortlich. Es waren dies Kurt Bandat für den Kernspeicher, Rudolf Bodo für die Architektur, Viktor Kudielka für den Trommelspeicher, Eugen Mühldorf für Ausgabegeräte, etwas später Peter Lucas und Hans Bekic für die Programmierung.
Meine Aufgabe war das Rechenwerk, mein Beitrag die Erfindung und Einführung dynamischer Schaltungstechnik mit Transistoren. Diese Technik war sparsamer und schneller als die damals gebräuchliche statische Technik mit Multivibratoren.
Es gab auch Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Universitäten und Firmen. Ich möchte vor allem die Kontakte mit dem Computerpionier Konrad Zuse, und Theodor Fromme, dem wissenschaftlichen Leiter der Firma Zuse, erwähnen. Die Firma Zuse wurde später von Siemens übernommen.
Wir hatten Erfolg. 1959, nach etwa dreijähriger Bauzeit, war das Maillüfterl verwendbar. Es war der erste in Europa in Transistortechnik gebaute Computer. Es wurden die Grundprogramme erstellt, etwa zum Einlesen von Daten und Programmen, eine bequeme Maschinensprache (Assembler), ein Compiler für die Programmiersprache ALGOL 60 entwickelt.
Führend waren Peter Lucas und Hans Bekic. Es wurden auch Rechenaufgaben für andere Institute übernommen. Und das Institut hat dann Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Programmiersprachen und der Bearbeitung logischer Aufgaben übernommen, die vom American Gouvernment finanziert wurden.
. Eine der ersten Rechenaufgaben, die mit dem Mailüfterl gelöst wurden, betraf eine musikalische Fragestellung. Es wurden sogenannte Zwölftonreihen gesucht, die einer bestimmten Eigenschaft gehorchten. Welche waren das, wie viele gab es davon? Das Mailüfterl benötigte dafür viele Stunden, musste auch über Nacht laufen, damals ein Stresstest zur Zuverlässigkeit. Durch eine Spezialschaltung konnten wir am Telefon, eben auch in der Nacht, hören ob alles richtig lief, Es gelang, am nächsten Morgen hatten wir das gewünschte Resultat!
Was hatten wir erreicht? Was war unsere damalige Sicht auf die elektronische Datenverarbeitung? Die Grundvorstellung war, dass der Computer dazu dient, etwas auszurechnen. Wir nannten den Computer damals auch noch “Rechenmaschine”. Es gab also jeweils ein Problem, ein Programm zu dessen Lösung, und eine Rechenmaschine, die mit dem Pogramm und den entsprechenden Eingangsdaten versorgt wurde und das Programm ausführte, die Lösung präsentierte. Das genannte Problem aus der Zwölftonmusik und seine Lösung sind ein gutes Beispiel dafür. Problemsteller, Programmierer und Computerbetreuer arbeiteten zusammen, waren manchmal auch dieselbe Person!
Wir dachten damals durchaus komplexe Anwendungen voraus. Lernende Programme, die automatische Übersetzung natürlicher Sprachen, Schachprogramme und andere Problembereiche, die man gerne unter dem Bergriff Artificial Intelligence zusammenfasst, waren Diskussionsthemen. Kleine Beispiele wurden auch realisiert, aber an eine umfassende Realisierung war damals noch nicht zu denken. Die Komplexität war nicht beherrschbar und die Leistungsfähigkeit der Computer bei weitem nicht ausreichend.
Die dramatische weitere Entwicklung der Datenverarbeitung kam aber dann mit den Möglichkeiten, die reale Welt sozusagen in die Computerwelt abzubilden. Fast alles was wir heute tun, findet seinen Niederschlag in der Computerwelt. Die Voraussetzungen dafür waren die leistungsfähige Datenspeicherung und Datenabfrage, die Vernetzung der Computer, und die Einbeziehung der Benutzer in die Abläufe in den Computern.
Die gesellschaftlichen Konsequenzen, die Veränderungen in der Arbeitswelt und im Umgang der Menschen miteinander, die sich daraus ergaben, haben wir damals, Ende der Fünfzigerjahre, in keiner Weise vorausgeahnt!
Wie ging es weiter? Die Weiterentwicklung der Hardware war in rasender Eile an uns vorbeigezogen. Sie wurde in den großen Laboratorien der Industrie vorangetrieben. Eine kleine Gruppe von Leuten an einer Universität, mit bescheidenen Mitteln ausgestattet, konnte wenig dazu beitragen. Unser Team löste sich auf, wir gingen in die Industrie und wendeten uns inhaltlich im wesentlichen der Software zu.
1961 gründete die Firma IBM eine Forschungsgruppe in Wien unter der Leitung von Heinz Zemanek, Mitarbeiter waren unter anderen Kurt Bandat, Hans Bekic, Viktor Kudielka und ich aus dem Mailüfterl-Team, Ernst Rothauser aus einer Gruppe des gleichen TU-Instituts, das an der Verarbeitung gesprochener Sprache gearbeitet hatte. Auch der Computer Mailüfterl übersiedelte zur IBM, steht übrigens heute im Technischen Museum in Wien. Manche der an der TU begonnen Arbeiten konnten hier fortgesetzt werden. Neben einem Projekt zur Verarbeitung gesprochener Sprache lag der Schwerpunkt unserer Arbeit bei der Programmierung, oder ganz allgemein ausgedrückt, bei der Übertragung von Problemen in eine vom Computer verarbeitbare Form. Das Mittel dieser Zeit waren Programmiersprachen, mit denen Programmierer Programme erstellten, die dann automatisch durch Compiler in die dem Computer verständliche Maschinensprache übersetzt wurden.
Aus diesem Szenario ergeben sich die folgenden Fragen: wie können wir sicher sein, dass die erstellten Programme das gestellte Problem korrekt lösen? Sind die Programmiersprachen in ihrer Bedeutung präzise und eindeutig definiert? Sind die Compiler korrekt? Die Forschungsgruppe widmete sich diesen Fragen. Beispiele dafür sind die Entwicklung von Ausdrucksmitteln, die näher am Problemgebiet liegen als die Programmiersprachen, von Methoden für den kontrollierten Übergang von diesen zur Ebene der Programmiersprachen, die Definition von Programmiersprachen mit mathematischen Mitteln, mathematische Beweise für die Korrektheit von Programmen, Methoden für den Entwurf von Compilern. Arbeiten wurden unter der Bezeichnung VDM, Vienna Definition Method, bekannt und noch heute als Formal Methods Europe weiter geführt. Peter Lucas war damals der führende Kopf.Wir waren nicht die einzigen, die sich mit diesen Fragen beschäftigten. Es gab regen wissenschaftlichen Austausch mit Fachleuten an Universitäten und in der Industrie, weltweit. Die Informatik war schließlich eine Disziplin steigender Bedeutung. Es konnten unzählige Kontakte hergestellt, auch Freundschaften geschlossen werden. Besonders in solchen Zeiten des Aufbruchs werden unterschiedlichste, interessante Leute sichtbar. Wir lernten viele kennen, unter ihnen auch Genies, Glücksritter und auch Spinner!
Die Wiener IBM Forschungsgruppe wurde dann zu einem IBM Laboratorium. Wir bekamen den Auftrag, die sehr umfangreiche und komplexe Programmiersprache PL/I formal, also mit mathematischen Mitteln, zu definieren. Die Entwicklung von PL/I, der Sprache und der Compiler, war Aufgabe des englischen IBM Labors in Hursley, uns oblag die mathematische Definition. Das bedeutete enge Zusammenarbeit, zeitweise verbunden mit dem täglichen Austausch von Dokumenten. Damals gab es noch kein Internet! Wir hatten eine Vereinbarung mit den Austrian Airlines, dass Piloten bei Flügen Wien-London unsere Dokumente in ihrem persönlichen Gepäck mitnehmen konnten. Heute nicht mehr vorstellbar, aber die Welt war damals noch nicht elektronisch vernetzt!
Es gab weitere Forschungsaufgaben und die Mitarbeit bei der Konzeption einer neuen Computerarchitektur.
1975 endete diese erste, forschungsorientierte, Phase des Wiener IBM Labors. 1976 übernahm ich von Zemanek die Leitung des Labors. Wir suchten und fanden neue Aufgaben in der Entwicklung kommerzieller Software. Auch dabei gab es Aufbruch in ein neue Welt. Software, die man ursprünglich frei mit den Computern den Kunden überlassen hatte, wurde zu einem neuen Geschäftsfeld.
Es begann die zweite, entwicklungsorientierte, Phase des Wiener IBM Labors. Wir gehorchten den Gesetzen der Produktentwicklung. Abschätzen der Marktchancen einer Produktidee, Erstellung von Entwicklungsplänen, Kontrolle der Entwicklung, Qualitätssicherung, Vorbereitung des Marketing, gehörten zu unseren Aufgaben. Qualität und Benützerfreundlichkeit der Produkte, und wirtschaftlicher Erfolg waren die Kriterien für unsere Arbeit.
Die Palette der entwickelten Produkte umfasste Werkzeuge für die Entwicklung und Betreuung von Anwendungen, wie Compiler für Programmiersprachen, aber auch etwa solche zur automatischen Erkennung gesprochener Sprache. Das Laboratorium Wien gehörte nach einigen Jahren zu den finanziell erfolgreichsten Software-Labors der Firma. Wir waren im internationalen Vergleich ein kleines Labor, konnten es aber immerhin zu einer Größe von 120 Mitarbeitern aufbauen.
Es gab intensive Zusammenarbeit mit anderen Entwicklungslabors und international vernetztes Management. Ich hatte zeitweise drei unmittelbare Chefs oder Chefinnen, für Österreich in Wien, in London oder Paris für Europa, und in Amerika für die weltweite Entwicklung.
Ich ging 1992 in den Ruhestand. Ich durfte dann noch einige Jahre eine Gastvorlesung über Systemanalyse an der TU Graz halten. Das war für mich die Rückkehr von Managementaufgaben zu professioneller Arbeit. Das Wiener IBM Laboratorium ist inzwischen Geschichte. Aber es gibt neue Aufbrüche.
Die Digitalisierung, ihre Bedeutung und ihre Auswirkungen, werden heute intensiv diskutiert. Wir sollten dabei übrigens nicht vergessen, dass die Digitalisierung bereits vor tausenden Jahren begonnen hat, nämlich mit der Verwendung beliebig sprachlich kombinierbarer Buchstaben und Ziffern!