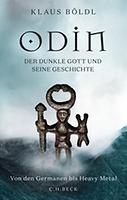Klaus Böldl: Odin#
Klaus Böldl: Odin. Der dunkle Gott und seine Geschichte. C.H. Beck Verlag München. 315 S., ill., € 28,-
Am zweiten Donnerstag im Advent toben in einer Untersberg-Gemeinde bei Salzburg zwölf furchterregende, maskierte Gestalten und schreien mit heiseren Stimmen "Wuotan, Wuotan!" Laut der Internetseite Salzburg-Wiki handelt es sich bei der "Wilden Jagd vom Untersberg" um einen "uralten Brauch", bei dem sich christliches Brauchtum, heidnische Überlieferung und historische Wahrheit verbinden. Vermutlich gehe das wilde Treiben auf keltische Rituale zurück, "die den Gott der Stürme und der kalten Winterwinde besänftigen sollten." Sicher jedoch ist, dass der Heimatpfleger Kuno Brandauer den Geisterzug 1949 eingeführt hat. Der Volkskundler wirkte in den propagandistischen Volkserziehungsinstituten Amt Rosenberg und SS-Ahnenerbe. "Gemeinsam mit dem Volkskundler Richard Wolfram hatte er den politischen Auftrag, den ehemaligen Salzburger Landestrachtenverband 1939 in die rassistische SS-Forschungs- und Lehrgemeinschaft 'Das Ahnenerbe' Heinrich Himmlers aufzunehmen." Trotzdem ernannte ihn die Landesregierung nach dem Zweiten Weltkrieg zum Leiter der neu eingerichteten Dienststelle für Heimatpflege. Bis heute führt eine Brauchtumsgruppe die "Wilde Jagd" nach seinen Regeln durch, die nicht verändert werden dürfen. Genaue Orts- und Zeitangaben sind nur Eingeweihten bekannt.
Solche Schilderungen machen stutzig, doch ist der Brauch nicht die einzige lebendige Reminiszenz an Wotan/Odin. Das erhellende Buch des Professors für Skandinavistik an der Universität Kiel und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Mainz, Klaus Böldl. Er liefert die erste Gesamtdarstellung zu Odin und seinem Kult. Der Autor prüft die archäologischen und literarischen Zeugnisse, bettet Odin in den Kontext der nordischen Religionen ein und beleuchtet die lange Rezeptionsgeschichte des dunklen Gottes vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Odin galt als oberster Gott der Germanen. Er war der Herr der Berserker, Herrscher über den Krieg und das Totenreich, ebenso wie Vegetationsdämon. Der Göttervater wurde mit Odysseus, Buddha oder Schamanen identifiziert. "Jedes Zeitalter und jede Fachdisziplin konstruiert sich ihre eigenen Odinbilder und schreibt so den Odinmythos fort. " In England nennt man ihn Woden, auf dem Kontinent Wodan, in Skandinavien ab dem späten 8. Jahrhundert Odin, im neueren Schwedisch Oden.
Die ersten Zeugnisse reichen in die Zeit der Wikinger (790–1070 n. Chr.) zurück, doch bleiben die Beschreibungen nebulos. Eine deutlichere Gestalt nahm der - zum Gestaltwandel fähige - Gott erst in der isländischen Saga-Literatur des Mittelalters an. In den Liedern der Edda - mythologische und heroische Überlieferungen des 13. Jahrhunderts - finden sich einige der bekanntesten Odin-Motive, wie Skaldenmet und Götterdämmerung, seine Einäugigkeit und die beiden Raben Hugin und Munin, die ihm alles zutrugen, was in der Welt vor sich ging. Verfasser der christlich überformten Prosa-Edda war der isländische Dichter und Historiker Snorri Sturluson (1179-1241). Klöster, sorgten für die Verbreitung des Textes.
In Deutschland setzte um 1500 das Interesse an der germanischen Vorzeit auf der Suche nach einer identitätsstiftenden Vergangenheit ein. Man orientierte sich vor allem an der um 100 entstandenen "Germania" des Tacitus, die schon früh gedruckt wurde. Für protestantische Geistliche wie Johann Gottfried Herder (1744-1803) entwickelte sich die germanische Religion und Mythologie zum "Steckenpferd" und "nicht wenige dieser Forscher hielten den Katholizismus für eine weitaus verderblichere Spielart des Heidentums." Seit dem späten 18. Jahrhundert wurde Odin in Abgrenzung zum romanischen Kulturkreis und zum Christentum immer stärker zum Nationalgott der Deutschen stilisiert. Die Spur führt von Jacob Grimm über Wagners "Ring des Nibelungen" bis zum Schweizer Psychiater C. G. Jung.
In ihrer Breitenwirkung kaum zu überschätzen ist Jacob Grimms (1785-1863) 1835 erschienene Deutsche Mythologie. "Besonders die Volkskunde und die Germanistik gerieten über Generationen in den Bann der 'wilden Philologie'. … Die Quellen wurden jedoch … vielfach aus dem Hut gezaubert," weiß Klaus Böldl. Grimm behauptete, Wotan sei von allen deutschen Stämmen verehrt worden - Beweise bleibt er schuldig. Dem Christentum sei es nicht gelungen, heidnische Vorstellungen zu eliminieren, Maria habe alle Merkmale der heidnischen Göttinnen absorbiert. Odins Raben vergleicht Grimm mit der Taube des heiligen Geistes. Als besonders wirkmächtig erwies sich die Annahme der Kontinuität von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart. "Seit Grimms Deutscher Mythologie war es gang und gäbe, das folkloristische Material, das überwiegend aus dem 17. bis 19. Jahrhundert stammt, als den alten mythologischen Quellen gleichwertig zu betrachten. Entscheidend für diese hohe Bewertung des 'Aberglaubens' war die Annahme einer Kontinuität von Sitten und religiösen Einstellungen. …Gerade das Beispiel Odin zeigt, wie wenig stichhaltig solche Kontinuitätsvorstellungen sind." Immer wieder erteilt der Autor diesen eine Absage, trotzdem erfreuen sich solche Spekulationen großer Beliebtheit.
"Ein wichtiger Ideengeber der völkischen Neuheiden im Hinblick auf esoterisches Gedankengut war der Österreicher Guido von List (1849-1919)." Der populäre Vertreter der völkischen Bewegung gilt als Begründer der rassistisch-okkultistischen Ariosophie. "Viele der heutigen rechtsextremen Neuheiden knüpfen an das krude und - wie sich in der NS-Diktatur eindrücklich zeigen sollte - brandgefährliche Weltbild der Völkischen an. Das dürftige Klischee vom tobenden Kriegsgott Wotan fasziniert dabei immer wieder neue Generationen von Rechten. … In den Jahrzehnten vor der nationalsozialistischen Machtergreifung zeigt eine ganze Reihe von Abhandlungen das anhaltende Interesse an Odin innerhalb und außerhalb akademischer Kreise. Zwei konkurrierende Wissenschaftler im Dritten Reich waren der deutsche Germanist Bernhard Kummer (1897-1962) und der österreichische Altnordist Otto Höfler (1901-1986)." Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Höfler eine Professur in München, ab 1957 in Wien. Seine Kernthese bestand in der Annahme von ekstatischen Männerbünden als zentrale soziale Institutionen. Er "war ein Schüler des deutschnationalen österreichischen Altphilologen Rudolf Much (1862-1936), einem Vertreter der sogenannten Wiener Schule, die auf der Linie von Jacob Grimm eine Kontinuität germanischer Sozialformen und Brauchtümer von der Urzeit bis in die Gegenwart nachweisen wollte. … Höflers These … ist wohl kaum mehr als ein Phantasma, das einem ideologischen Bedürfnis entgegenkommt. … Indessen wirken viele Theorien und Vorstellungen , die vor 1945 entwickelt wurden, nicht nur in der Forschung, sondern besonders auch in rechtsextremen Kreisen und sogar in der Populärkultur weiter."
Seit den 1980 er Jahren ist Odin in der Metal Music präsent. Rund drei Dutzend Bands veröffentlichen Titel, die sich um ihn drehen. Viele Menschen tragen T-Shirts, Amulette oder Schmuckstücke mit Odinmotiven. In der Jugendkultur scheint Odin im weitesten Sinne für Subversion, den Ausbruch aus der Zivilisation, zu stehen. Seit dem 18. Jahrhundert haben seine Mythen Künstler zur kreativen Auseinandersetzung motiviert, neuheidnischen und rechts orientierten Kreisen reichlich Stoff geboten. "In diesem Sinne ist die Odinmythologie keineswegs eine abgeschlossene, ihre Weiterentwicklung ist vielmehr nach wie vor in vollem Gange und ein Ende gar nicht abzusehen."