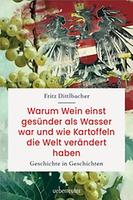Fritz Dittlbacher: Warum Wein einst gesünder als Wasser war…#
Fritz Dittlbacher: Warum Wein einst gesünder als Wasser war und wie Kartoffeln die Welt verändert haben. Geschichte in Geschichten. Ueberreuter Verlag Wien. 184 S., € 26,-
"Geschichte ist nicht alles, was sich ereignet. Geschichte ist das, was aufgeschrieben, erfasst und überliefert wird. Unser Geschichtswissen speist sich aus Literatur und Quellen. Fehlt beides, haben wir Pech gehabt," weiß der Chefreporter der "Zeit im Bild" im ORF, Fritz Dittlbacher. Der promovierte Historiker und diplomierte Kommunikationswissenschaftler ist aber nicht nur Politikjournalist, er hat auch eine fixe Rubrik in der Infotainment-Sendung "Studio 2". Dort präsentiert er Erstaunliches aus der Geschichte. Darauf basiert das Buch "Warum Wein einst gesünder als Wasser war…" Es hat gute Chancen, ein Bestseller zu werden, wie 2022 "Warum in Wien das Römische Reich unterging und Vorarlberg nicht hinterm Arlberg liegt". Diesmal richtet sich der unterhaltsame Blick hinter die Kulissen der Geschichte auf "Essen und Trinken", die "Geschichte der modernen Werkzeuge", "Geschichte vorm Anthropozän", Feiertage, Gesellschaft, "Länder an der Kippe", "Berühmtheiten und Bösewichter."
Warum Wein in Wien gesünder als Wasser war, ist schnell erklärt. Es lag an den unhygienischen Verhältnissen. Vor dem Bau der Hochquellenleitungen gab es nur Hausbrunnen, und diese waren oft durch Abwässer verunreinigt. Kanäle bestanden nur in der Innenstadt – allerdings als erste Stadt Europas schob 1739. Regelmäßig traten Seuchen auf, vor allem die Cholera. Noch im Weltausstellungsjahr 1873 forderte die Epidemie in Wien fast 3000 Tote. Wer gesund bleiben wollte, griff zu Wein oder Bier, die einen weit niedrigeren Alkoholgehalt hatten als heutzutage. Komplizierter verlief die Geschichte der Kartoffeln. 1573 wurden Papas oder Patatas in Sevilla aktenkundig. Die Feldfrüchte, die die Spanier aus Amerika mitbrachten, galten als besonders gesund. Auch waren sie leichter zu gewinnen und zu verarbeiten als Getreide. Bis zum feldmäßigen Anbau vergingen in Deutschland Jahrhunderte. Dem preußischen König Friedrich II., der sich für das neue Grundnahrungsmittel einsetzte, trugen sie den Spottnamen "Kartoffelkönig" ein. Auch Maria Theresia blieb mit ihren diesbezüglichen Bemühungen erfolglos. Erst die Hungersnöte Anfang des 19. Jahrhunderts machten die Erdäpfel populär. Kartoffeln wurden zum "Superfood" der Industrialisierung. Am Jahrhundertende lag der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch bei 200 Kilo. Heute sind es in Österreich bei 60 Kilo, in Großbritannien 90, in Weißrussland 120 (der Verbrauch für die Wodka-Erzeugung eingerechnet).
immer wieder überraschen aktuelle statistische Angaben, die hier keineswegs trockene Zahlen sind, sondern den vom Autor intendierten Aha-Effekt hervorrufen. So erfährt man über die "Geschichte der modernen Werkzeuge", dass der Apple Macintosh 128K , der erste Computer mit einer Maus, 1984 auf einen Arbeitsspeicher mit 128 Kilobyte zugriff. 40 Jahre später verfügen PCs über mehr als das Hunderttausendfache. Ein i-Phone hat die 40.000-fache Rechenleistung seines Apple-Urahnen - der nach heutiger Kaufkraft rund 10.000 € kostete.
"Die Geschichte vom Anthropozän", des Erdzeitalters des Menschen, begann vor etwa zwei Millionen Jahren. Sie ist von Erfindungen, Erfolgen und Misserfolgen gekennzeichnet. "Alles geht heute im Rekordtempo vor sich. Politische Entwicklungen, technischer Fortschritt, ökonomischer Wandel, Bevölkerungswachstum, globaler Temperaturanstieg, das Aussterben von Arten, die Ausbreitung von Krankheiten …" Das geht rasend schnell vor such und kann Angst machen. Der Autor nennt auch Gründe "Wieso die Welt doch besser wird": Die Lebenserwartung stieg seit 1800 von 33,3 auf 79,4 bzw. 84,2 Jahre. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf hat sich seit 1960 vervierfacht. Die globale Alphabetisierungsrate lag 1950 bei 36 %, jetzt bei 86,8 % (trotz gegenläufiger Tendenzen). Der Ertrag von Getreide je Hektar stieg in den letzten 60 Jahren von rund 1,4 t auf knapp 3,8 t, der von Mais hat sich verdreifacht.
Kapitel 4 handelt von Festen und Feiern. Dabei dürfen die Schulferien nicht fehlen. Im antiken Rom dauerten die "Feriae scholarum", daher der Name, vier Monate im Sommer. Der Grund lag – wie später auch bei uns – darin, dass bei fast ausschließlich agrarischer Bevölkerung in der Erntezeit jede Arbeitskraft gebraucht wurde. "Mit aktuell neun Wochen Sommerferien und all den anderen freien Tagen sind die schulfreien Zeiten in Österreich gut doppelt so lange wie vor 250 Jahren, zur Zeit der Einführung des allgemeinen Schulunterrichts. Österreich befindet sich damit im internationalen Durchschnitt. In den USA wie in Russland dauern die Schulferien rund drei Monate, ebenso in Italien, Griechenland und Kroatien. In nördlicher gelegenen Ländern wie Deutschland, Holland oder England sind es sechs bis sieben, in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz elf Wochen. Nur im asiatischen Inselstaat Ost-Timor gibt es de facto durchgehenden Schulunterricht.
Im Abschnitt über das Zusammenleben erinnert der Autor u. a. an "das Leben unserer Urgroßmütter" und daran, dass "der Weg zu Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Mann und Frau noch nicht sehr lange beschritten und noch lange nicht am Ziel angelangt" ist. Beim Hainfelder Parteitag 1888, dem Gründungstreffen der österreichischen Sozialdemokratie war unter 110 Delegierten eine einzige Arbeiterin. Sie durfte aber nicht an der Versammlung teilnehmen – In der Monarchie galt ein Verbot der Mitgliedschaft in politischen Vereinen für Frauen. Erst 1919 durften sie in Österreich wählen und gewählt werden. In Frankreich waren sie erstmals 1945 wahlberechtigt, in Italien 1946 und in der Schweiz auf Bundesebene erst 1971. Seit 1878 konnten Mädchen ein Gymnasium, aber nicht die Universität, besuchen. Vor 1957 brauchten Ehefrauen die Erlaubnis ihres Mannes, wenn sie ein Bankkonto eröffnen wollten, bis 1975 die Genehmigung zur Berufstätigkeit. Bis 1989 konnte eine ledige Mutter nicht Vormund ihres Kindes sein. Wenn auch das Familienrechts-Paket in der Ära Kreisky Verbesserungen brachte, ist im täglichen Leben noch viel aufzuholen.
Im 6. Kapitel erklärt der erfahrene Politikjournalist, was "Länder an der Kippe" besser machen könnten. Argentinien, das Silber-Land, war noch 1950 das reichste der Welt. Mittlerweile ist der achtgrößte Staat "ein krisengebeuteltes Schwellenland geworden." Der Populist Juan Perón verdreifachte nach seiner ersten Wahl zum Präsidenten 1946 binnen drei Jahren die Staatsausgaben. Nach dem Sturz des Ex-Generals wurde es nicht besser. 2002 wechselten binnen Azwei Wochen fünf Männer im Präsidentenamt. 2023 gewann Javier Milei, Gründer einer libertären, ultrarechten Partei, die Präsidentschaftswahlen. "Die Hoffnungen auf eine Erholung wurden immer kleiner, die angebotenen Lösungen immer radikaler … Wenn so lange so viel schiefgegangen ist, lebt offenbar auch die Hoffnung etwas länger."
Das letzte Kapitel widmet Fritz Dittlbacher "Berühmtheiten und Bösewichtern". Dazu zählt er Stalin, Mussolini, Napoleon, Päpste, Kennedy und Kissinger. Als Resümee schreibt der Autor: "Leben wir im Goldenen Zeitalter des Wissens? Nicht ganz. …. Wissen wirkt aber nur dann, wenn es von vielen gewusst wird. Dieses Buch ist Teil eines Projektes, das dazu beitragen will. … Worauf ich spezialisiert bin, ist die Wissensvermittlung, das Übersetzen ins Verständliche und hoffentlich auch Interessante. Denn das ist das, was Journalismus eigentlich ausmacht: Fakten herausfinden und möglichst spannend weitererzählen, bewerten, was wichtig und was relevant ist. Die Rolle des Journalismus wird häufig so beschrieben: Schleusenwärter am Strom der Information." So ist das ebenso unterhaltsame wie seriöse Buch nicht nur ein lesenswerter "Geschichtsunterricht ", wie man ihn nur selten findet, sondern auch ein beispielgebendes Lehrstück des journalistischen Handwerks.