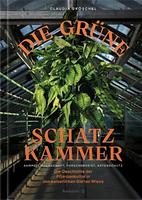Claudia Gröschel: Die grüne Schatzkammer#
Claudia Gröschel: Die grüne Schatzkammer. Sammelleidenschaft, Forschergeist, Artenschutz. Die Geschichte der Pflanzenkultur in den kaiserlichen Gärten Wiens. Mit Beiträgen von Christian Berg, Stephanie Socher und Michael Kiehn, Michael Knaack, Nils Köster, H. Walter Lack, Heimo Rainer und Andreas Berger, Oliver Rathkolb, David Stuart, Clemens Alexander Wimmer. Verlag Brandstätter Wien. 304 S. ill., € 45,-
Das ist ein Buch, von dem nicht nur Pflanzenfans begeistert sein werden. Namhafte AutorInnen berichten kompetent über die mehr als 450-jährige Geschichte der Botanischen Sammlungen in Wien. Dazu kommen Artikel zu Spezialthemen, beispielsweise über Alexander von Humboldt, die Brasilienexpedition 1817, Aronstabgewächse, Herbarien, Orchideen, die Gärtner-Bibliothek und die Pflanzenwelt Australiens. Doppelseitige Fotos und Pflanzenportraits geben Einblick in die grüne Schatzkammer der ehemals kaiserlichen Gärten Wiens. Besonders reizvoll sind viele Illustrationen nach historischen Aquarellen, die rare Gewächse minutiös abbilden. Auch das großzügige, übersichtliche Layout verdient Lob. Mit einem Wort: Man kann ein solches Buch nicht besser machen.
Heute betreuen die österreichischen Bundesgärten etwa 150.000 Einzelpflanzen in 17.000 Arten und Sorten im Wiener Schlosspark Schönbrunn, Belvederegarten, Burggarten, Augarten und im Hofgarten in Innsbruck. Die reichen Bestände in den Glashäusern und im Freien gehen auf kaiserliche Gärten zurück. Renaissancefürsten wie Ferdinand I. und sein Sohn Maximilian II. sammelten Kunstwerke, Naturalien, Exotika, Kuriositäten und technische Geräte in Kunst- und Wunderkammern. Maximilian II., der das vielseitige Interesse seines Vaters teilte, begeisterte sich besonders für Gartenkunst und Pflanzenkultur. Er plante das Neugebäude in Simmering als Kunstgalerie und Zentrum einer prachtvollen Parkanlage. Der tolerante Kaiser studierte europäische Vorbilder und holte Experten an seinen Hof, darunter die Botaniker Pietro Andrea Mattioli und Carolus Clusius. "Clusius, ab 1573 Hofbotaniker in Wien, kultivierte Blumenzwiebeln und Gehölze im kaiserlichen Garten und schickte deren Samen an befreundete Botaniker. Auf diese Weise wurden Tulpen, Kaiserkronen und Kastanien in ganz Europa verbreitet." Sie waren kostbar wie Kunstgegenstände, wurden wie solche in den Gärten präsentiert und zeigten das Selbstverständnis der Kaiser als Herrscher über die Natur. Die ersten exotischen Pflanzen, die schon im Mittelalter über die Alpen gebracht wurden, waren Zitrusfrüchte. Zur Überwinterung brauchten sie Orangerien.
Zur Barockzeit blühte in Schönbrunn schon der Flieder, um 1660 waren es 100 Kübel mit "welschen Bäumen". Eine Generation später baute Johann Bernhard Fischer von Erlach das Schloss neu und der französische Gartenarchitekt Jean Trehet plante den Park. Dazu kaufte er u.a. 1000 Buchsbäumchen. Kaiser Karl VI. besaß Pomeranzen und 800 Nelkenstöcke. Seine Schwägerin, die Schönbrunn als Witwensitz nützte, verflügte über 900 Pomeranzen und ebenso viele indanische, afrikanische und heimische Pflanzen, darunter Agaven, Opuntien, Zypressen und Granatäpfel. Übertroffen wurde die Sammlung von der Kollektion des Prinzen Eugen. Er ließ am Rennweg mehrere Gebäude errichten und einen Garten anlegen. Das Untere Belvedere diente als "Orangerieschloss". Um 1720 sollen sich im Belvedere-Garten 2000 Pflanzen - darunter Agave, Banane und Kaffee - befunden haben, die aus Italien, Indien, Peru und dem osmanischen Reich nach Wien gebracht worden waren. Außerdem besaß der "edle Ritter" mehr als 250 botanische Werke in seiner Bibliothek. Nach seinem Tod übernahm das Kaiserhaus die Pflanzen, ein Teil kam nach Schönbrunn. Heute befinden sich der Alpengarten und die Bonsaisammlung der Republik Österreich bei, Belvedere. In den Glashäusern des Reservegartens gedeihen die Sammlung der "Neuholländer" und Bromelien.
Franz Stephan und Maria Theresia ließen beim Ausbau von Schönbrunn einen Botanischen Garten anlegen. Im "Holländischen Garten" Abteilungen wuchsen Obst, Gemüse und Blumen. Pomeranzen und Pfirsiche gediehen in Glashäusern. Ananas waren als "geschmackergötzendes Wunder der Natur" für die kaiserliche Tafel besonders geschätzt. Sie erhielten eigene Treibhäuser. Entlang der Gartenmauern wurden Birnenspaliere und Wein gezogen. Die fast 190 m lange große Orangerie entstand 1754. Im gleichen Jahr starteten der Botaniker Nikolaus Joseph Jaquin und der Gärtner Ryk van der Schot in allerhöchstem Auftrag zu einer Forschungsreise in die Karibik. Sie schickten von dieser und zwei weiteren Expeditionen kistenweise Pflanzen, Tiere und andere Fundstücke nach Wien. Der Frachtraum der Schiffe reichte dafür nicht aus.
Auch der als sparsam bekannte Joseph II. schickte 1785 zwei Hofgärtner nach Südafrika und Mauritius. Besonders interessierten den Kaiser Pelargonien, die damals in europaischen Gärten fast unbekannt waren. Anfang des 19. Jahrhunderts gelang die Züchtung von Hybriden. Wien war eines der Zentren. Der kaiserliche Beamte Jakob Klier kultivierte in seinem "Pelargonien-Tempel" 400 Arten. Die habsburgische Sammlung umfasste anno 1834 gezählte 2795 Geranien in 539 Arten. Aus den kaiserlichen Gärten sind zahlreiche Pflanzenillustrationen erhalten, die älteste aus dem Jahr 1768. Von Nikolaus Joseph Jaquin erschien um 1800 ein vierbändiges Werk mit Beschreibungen und Abbildungen der raren Gewächse. Sie waren, da Österreich über keine überseeischen Besitzungen verfügte, im Handel erworben worden. "Sie machten die kaiserlichen Gärten zu einer 'vegetabilischen Schatzkammer' von universellem Anspruch. Ihr Inhalt sollte wegen seiner Fragilität dauerhaft im Bild festgehalten werden." Die älteste lebende Pflanze ist "die alte Dame von Schönbrunn". Diese Fockea Capensis kam 1799 - damals weit über 250 Jahre alt - nach einer Südafrika-Expedition nach Wien. Inzwischen ist sie "die älteste sukkulente Topfpflanze der Welt".
Bis 1778 waren die Botanischen Sammlungen der Habsburger nur für auserwählte Gäste zu sehen, die der Hofgartendirektor persönlich führte. Seit 1827 wurden einzelne Exemplare in jährlichen Pflanzenausstellungen gezeigt, aus denen die k. k. Gartenbaugesellschaft entstand. "Endgültig für die Bevölkerung geöffnet wurden die Sammlungen nach dem Bau des Großen Palmenhauses in Schönbrunn, das seit 1883 … zugänglich ist." Das Palm House in Kew bei London war das Vorbild für den 90 m langen, überkuppelten "Palast für exotische Pflanzen". Er umfasst drei Pavillons für verschiedene Klimazonen und beinhaltet mehr als 5000 Gewächse. Die Eisenkonstruktion war schuppenförmig zweischalig verglast. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten Druckwellen die Verglasung. 1952 war die Reparatur vorläufig abgeschlossen, doch blieb das Gebäude bis 1976 für Besucher geschlossen. 1986 wurde es saniert, doch erwiesen sich 2011 bis 2014 weitere Reparaturen als notwendig. Das Große Palmenhaus ist nicht das einzige in Schönbrunn. Ihm gegenüber erhebt sich das 1904 fertiggestellte Sonnenuhr- jetzt Wüstenhaus. Kaiser Franz Joseph I ließ es zur Überwinterung seiner wertvollen Pflanzen aus Australien und Südafrika errichten. Nach einem Jahrzehnt wurde daraus eine Schausammlung für Kakteen und Sukkulenten. Seit 2003 führt ein Erlebnispfad durch Fauna und Flora der Wüstenlandschaften von Mittelamerika bis Madagaskar. Im Burggarten in der Inneren Stadt plante Friedrich Ohmann das 1901 eröffnete Glashaus. Das Palmenhaus im Augarten, ein halbes Jahrhundert älter als jedes in Schönbrunn, zählt zu den ersten Europas. Von der Barockzeit bis 1918 diente der Augarten als Reservegarten der Hofburg. Heute befinden sich hier Canna, Feigen, Hibiscus und große Solitärpflanzen. Das historische Palmenhaus ist zur Event-Location geworden.
Nach dem Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie kamen die Pflanzensammlungen in den Besitz der Republik Österreich. Die Bundesgärten haben eine zusätzliche Aufgabe bekommen. Als "Hort der Pflanzenvielfalt" dienen sie der Arterhaltung und dem internationalen Austausch. Die "Pflanzenarche" bewahrt Sorten, die in ihrer Heimat ausgestorben sind. "Jedes Jahr schicken die Österreichischen Bundesgärten 1000 bis 1500 Samenpackungen in die ganze Welt. … Die Botanischen Sammlungen der österreichischen Bundesgärten sind ein Teil des historischen Erbes Österreichs."