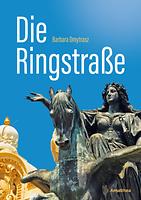Barbara Dmytrasz: Die Ringstraße#
Barbara Dmytrasz: Die Ringstraße. Der ideale Begleiter durch das Herz von Wien. Amalthea-Verlag Wien. 272 S. ill., € 28,-
Es wird hier erstmals der Versuch unternommen, das Zusammenspiel von Kunst und Geschichte zu enthüllen, liest man im Vorwort der Historikerin und Pädagogin Barbara Dmytrasz. Ihr Standardwerk über den "Ring" erscheint nun schon in vierter Auflage, überarbeitet, erweitert und durchgehend mit aussagekräftigen Farbfotos - meist von Peter Szabo - illustriert.
Die Ringstraße war das größte städtebauliche Projekt des 19. Jahrhunderts in Europa. Die Voraussetzung bildete das berühmte Handschreiben Kaiser Franz Josephs an seinen Innenminister: "Es ist mein Wille…", dass die historischen Befestigungsanlagen der Residenz- und Reichshauptstadt geschleift werden sollte. Der Beschluss zur Anlage des ca. 5 km langen hufeisenförmigen Boulevards kam 1857 einem Weihnachtsgeschenk für die WienerInnen gleich (über das sich viele nicht freuten). Wenige Monate später begann der Abriss - von Johann Strauss mit der Demoliererpolka gewürdigt. Die feierliche Eröffnung des neuen Straßenzuges erfolgte am 1. Mai 1865, fünf Jahre später wurde ein weiterer Teil für den Verkehr freigegeben. Den Abschluss bildete 1913 das k.u.k. Kriegsministerium, damals das modernste Bürogebäude der Stadt.
Barbara Dmytrasz legt besonderes Augenmerk auf die militärische Bedeutung der Ringstraße: Die neoabsolutistische Herrschaft Kaiser Franz Josephs I. gleicht am Beginn seiner Regierungszeit einer Militärdiktatur. … Es drängt sich somit auf, den versteckten militärischen Charakter der Anlage zu demaskieren. Als Argumente dienen der Autorin die Straßenbreite von fast 57 m (zur Erleichterung von Truppenverschiebungen), die gerade angelegten Abschnitte des Polygons (für freie Schuss-Strecken) und das Festungsdreieck der Defensivkasernen mit seinen "Nebenstationen."
Ein internationaler Architektenwettbewerb erbrachte 85 Einreichungen für den Boulevard (von "Bollwerk"). Organisation und Finanzierung oblagen dem Stadterweiterungsfonds. Er dürfte gut gewirtschaftet haben, denn noch bei seiner Auflösung nach 160 Jahren (2017) blieb ein Vermögen von 340.000 €. Der Fonds gab 2,4 Mio. m² Grund zur Bebauung frei, mehr als die Hälfte entfiel auf Verkehrsflächen und Parkanlagen. An öffentlichen Gebäuden entstanden u.a. Oper, Burgtheater, Kunst- und Naturhistorisches Museum, Parlament, Rathaus und Universität. Die Hälfte der Baugründe erwarben Private. Unter den großbürgerlichen Hausherren waren 44 % jüdische Familien. Sie durften erst ab 1860 Grundbesitz erwerben. Nur zwei der rund 850 Gebäude standen im Eigentum von Habsburgern, sieben von Angehörigen des Blutadels. Als neuer Bautypus entstand das Zinspalais als Investitionsobjekt, Wohn- und Repräsentationsbau. Die Autorin stellt 20 Ringstraßenpalais vor. Für dieses Kapitel wählte sie den dramatischen Titel Adel und Bürgertum rüsten zum Showdown (d.h. Kräftemessen, Endkampf) .
Das Buch gliedert sich in acht Themenkreise. Der Einführung in die Geschichte der Wiener Ringstraße folgen militärhistorische Überlegungen - Ein Boulevard gegen Revolutionäre ?. Sie behandeln die - von Anfang an bei den Untertanen unbeliebte - Rossauer Kaserne, das Deutschmeisterdenkmal, das ehemalige Kriegsministerium und das Radetzkydenkmal. Anders als dieses 1892 enthüllte Monument, das die militärische Überlegenheit der österreichischen Armee symbolisiert, folgt das Deutschmeisterdenkmal einer anderen Idee: Es war das erste, das dem einfachen Soldaten Achtung entgegenbrachte und nicht dem Feldherrn, und wurde mit Spendengeldern aus der Wiener Bevölkerung finanziert.
Dem Platz der imperialen Selbstdarstellung sind die nächsten mehr als 50 Seiten gewidmet. Es geht um das Kaiserforum, die Neue Burg, die Reiterdenkmäler auf dem Heldenplatz, das Äußere Burgtor, den Maria-Theresien-Platz mit seinem namensgebenden Denkmal und den ehemaligen Hofmuseen und - jenseits der Lastenstraße - um das Museumsquartier in den barocken Hofstallungen. Vorbild für das Kaiserforum, das Gottfried Semper plante, war das Trajansforum in Rom. Sein historistisches Wiener Pendant blieb wegen des Ersten Weltkriegs ein Torso. Trotzdem ist die Hofburg, die seit dem 13. Jahrhundert entstand, mit ihren 18 Trakten und 19 Höfen auf 240.000 m² die größte Palastanlage Europas.
Der Triumph des liberalen Bürgertums manifestierte sich in der Anlage eines "Bürgerforums" an der stadtauswärtsseitigen Seite der Ringstraße. … Diese bürgerlichen Repräsentationsbauten waren im ursprünglichen Konzept der Ringstraße nicht vorgesehen. Die 1365 gegründete Wiener Universität war die älteste im deutschen Sprachraum. 1884 wurde der Neubau an der Ringstraße eröffnet. Ihr Planer war Heinrich Ferstel, von dem u. a. die Votivkirche stammt. Die Architekten des Historismus verfolgten das Ideal der sprechenden Architektur. Die Bestimmung eines Bauwerks sollte auf den ersten Blick erkennbar sein. Die Universität, in Formen der italienischen Renaissance, vermittelt das humanistische Weltbild jener Zeit. Das Parlament entwarf Theophil Hansen in Anlehnung an die griechische Antike, denn die Griechen galten als Wegbereiter der Demokratie. Für das neogotische Rathaus ließ sich Dombaumeister Friedrich Schmidt vom Brüsseler Rathaus inspirieren. Der Justizpalast ist ein Werk von Alexander Wielemans, einem Schüler Friedrich Schmidts. Er orientierte sich an der in der Frühphase des Historismus äußerst populären deutschen Renaissance und baute diese in barocker Monumentalität aus.
In der Darstellung folgen sieben Gebäude der Kunste: Burgtheater, Akademie der bildenden Künste, Staatsoper, Musikverein, Künstlerhaus, Secession und Museum für angewandte Kunst. Im Historismus zeigte sich, wie schon in der Barockzeit, das verstärkte Engagement des Herrscherhauses als Mäzen. Die in Wien geschaffene Kunst wurde zum Vorbild für die gesamte Monarchie. … Seit den 1880er Jahren errichteten die Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer beinahe 50 Theaterbauten in der Donaumonarchie. Sie bezogen sich dabei auf die Wiener Oper.
Nach der detailreichen Vorstellung von Palais und Mietpalais im Kapitel Showdown geht es zu einem Ort des Gedenkens, zum - von der prominenten Historismusexpertin Renate Wagner-Rieger so genannten - Probegalopp der Ringstraßenzone, der Votivkirche. Der Grundstein wurde 1856 gelegt, am zweiten Hochzeitstag von Franz Joseph I. und Elisabeth von Bayern. Die feierliche Einweihung fand am Tag der silbernen Hochzeit statt, am 24. April 1879. Die Ausschreibung gewann der 26-jährige Heinrich Ferstel unter 75 Projekten. Als avancierter Architekt verwahrte er sich gegen die Aufstellung des Tegetthoff-Denkmals in der Blickachse ebenso wie gegen einen neogotischen Universitätscampus im Hintergrund.
Im letzten Kapitel, das sie Opposition gegen das Kaiserhaus betitelt, stellt Barbara Dmytrasz vier prominente Jugendstilbauten vor. Einleitend hatte sie gemeint: Das Buch wendet sich an alle historisch Interessierten und lädt dazu ein, das Gesamtkunstwerk Wiener Ringstraße mit neuen Augen zu sehen. Folgt man der Autorin, bleiben (sozial-) kritische Blicke nicht ausgespart. Einige außerhalb der Ringstraße gelegene Objekt finden ihre Würdigung, wie auch die internationalen Vorbilder der Wiener Monumentalbauten. Beim Entdecken des vermeintlich Wohlbekannten helfen die exakte Beschreibung der Baudetails, die man selten so findet, ebenso wie die Pläne auf den Umschlaginnenseiten.
hmw