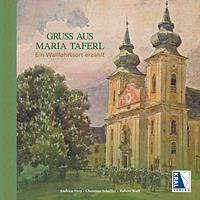Andreas Frey, Christian Schüller, Robert Wolf: Gruss aus Maria Taferl#
Andreas Frey, Christian Schüller, Robert Wolf: Gruss aus Maria Taferl. Ein Wallfahrtsort
erzählt. Kral Verlag Berndorf/Marktgemeinde Maria Taferl. 242 S., ill. € 34,90
Ein Wallfahrtsort hat viel zu "erzählen", umso mehr, wenn es sich um den größten Niederösterreichs handelt. Vor nicht allzu langer Zeit gedachte Maria Taferl des ersten Gottesdienstes vor 350 Jahren, heuer sind es 365 Jahre. Doch auch ohne rundes Jubiläum lohnt sich die Herausgabe es eines reich illustrierten Buches. Schon der Titel verrät den roten Faden. "Gruß aus …" war der gängige Aufdruck der Ansichtskarten. Zahlreiche Correspondenz-Karten zeigen in hervorragender Reproduktion die versandten Grüße der Wallfahrer und Besucher an die Daheimgebliebenen. Das Autorenteam beginnt sein Buch mit der Entstehung der Ansichtskarte.
Die Correspondenz-Karte trat 1869 ihren Siegeszug von Österreich-Ungarn aus an. Innerhalb weniger Monate verkaufte die Post drei Millionen Stück. Das neue Kommunikationsmittel wurde schneller zugestellt und kostete weniger Porto als ein Brief. In den 1890 er Jahren begannen Postkartenverlage Ansichten auf die eine Seite der Karten zu drucken. Bis 1904 war die ganze andere Seite für die Adresse reserviert. Erst dann erhielt die Rückseite einen "Teilungsstrich", sodass man die Grußworte nicht mehr auf die Bildseite schreiben musste. Bei der Ausführung - meist im Druckverfahren der Chromolithographie - gab es viele Möglichkeiten: mit Gründerzeit- oder Jugendstildekorationen, auf ausgestanztem Karton, geteilte Bildfläche mit mehreren Ansichten und vieles andere mehr. 1895 bis 1918 gilt als Blütezeit der Ansichtskarten, bei deren Verkauf sich Devotionalienhändler, Greissler und Gasthäuser konkurrenzierten.
Der Beginn des Gnadenortes fällt in die Zeit der Gegenreformation (1545 - 18. Jahrhundert). 1633 wollte ein Hirte eine dürre Eiche fällen und sah nicht, dass sich darin ein Kreuz befand. Er verletzte sich, doch die Wunden heilten wunderbarerweise. Neun Jahre später ersetzte ein psychisch kranker Förster das morsche Kreuz durch eine Madonnenstatue, auch er wurde geheilt. In den folgenden Jahren erzählten verschiedene Personen von Licht- und Engelserscheinungen auf dem Taferlberg. Man errichtete eine hölzerne Kapelle. Die kirchliche Obrigkeit erlaubte, dort Gottesdienste zu feiern. Der erste fand am Fest des hl. Joseph 1660 statt. Wenig später erfolgte die Grundsteinlegung zur Kirche, die zahlreiche Pilger anzog. 1707 entwarf Jakob Prandtauer, der Architekt des Stiftes Melk, die Kuppel. Zwei Generationen später malte der ebenfalls in Melk tätige Antonio Beduzzi die Fresken mit Szenen aus dem Marienleben. Der Hochaltar aus vergoldetem Kupfer umschließt das Gnadenbild, eine relativ kleine Pietà. Sechs Seitenaltäre mit Bildern von Johann Georg Schmidt vervollständigten die barocke Ausstattung.
Zu jedem Wallfahrtsort gehören Votivbilder, in Maria Taferl gibt es allein am Aufgang zur Orgel rund 1500. Weitere - wie das älteste aus dem Jahr 1777 - befinden sich in der Schatzkammer. Das Votivbild ist ein Gegenstand, den ein Mensch als Einlösung eines Versprechens - vor allem als Zeichen des Dankes für die Rettung vor einem Unglück, aber auch als Bitte um Erlösung aus einer Notlage - an Wallfahrtsorten opfert … die Geburt eines Kindes, Glück und Unglück des Menschen, Unfälle bei der Arbeit sowie Krankheiten bei Menschen und Tieren, schreiben die Autoren.
Alle drei sind mit Maria Taferl eng verbunden. Der Hobbyhistoriker Andreas Frey betreibt das seit dem 17. Jahrhundert bestehende renommierte Wirtshaus "Zum goldenen Löwen". Christian Schüller, mit seiner "Genusswerkstatt" ein direkter Nachbar der Basilika, leitete die Kirchenrenovierung. Der Ethnologe Robert Wolf war Marketingchef bei den ÖBB. Nun beschäftigt er sich mit der Geschichte der Marktgemeinde, in der er seit der Pensionierung lebt. Neben vielen anderen wissenswerten Details haben die Autoren Häuserchroniken der Katastralgemeinden zusammengestellt.
Den Hauptort Maria Taferl dominiert die Wallfahrtskirche, in deren Umgebung sich Devotionalienhändler und ein Dutzend Hotels und Gasthäuser ansiedelten. Eine Sehenswürdigkeit ist die mechanische Krippe aus dem Jahr 1902, eine der größten und ältesten Österreichs. Durch eine Glastür stets zu besichtigen, stellt sie Geburt und Leben Jesu, das ländliche Leben und die Entstehung von Maria Taferl dar. Ein weltliches Pendant ist das elektromechanische Alpenpanorama aus dem Jahr 1910. Im kleinsten Ortsteil, Wimm, begann vor 3600 Jahren die Siedlungsgeschichte der Marktgemeinde. Archäologen entdeckten Friedhöfe aus der Bronze-, Kelten- und Awarenzeit. Die restaurierten Funde befinden sich im MAMUZ-Urgeschichtsmuseum Asparn (nicht Aspang) an der Zaya. Oberthalheim ist heute durch seinen Reitsportclub ein Begriff. Unterthalheim war Jahrhunderte lang eng mit der nahen Gemeinde Artstetten verbunden. Im dortigen Schloss befand sich der Wohnsitz Erzherzog Franz Ferdinands. Ihm sind im Buch mehrere Kapitel gewidmet. Reitern wurde 1910 auf einer Ansichtskarte als "Ausflugsort von M. Taferl mit prachtvoller Fernsicht auf die Alpenkette" gelobt. Das Gasthaus, das die Karten vertrieb, besteht nicht mehr. Untererla liegt einen Kilometer Luftlinien nordwestlich von Maria Taferl. Vor 200 Jahren eine beliebte Sommerfrische, ist es seit Anfang des 21. Jahrhunderts für den von der "Talenteschmiede" gestalteten Familienwanderweg bekannt. Obererla mit Hilmanger nennt die Steinbachklamm sein Highlight. Auf einem dreistündigen Rundwanderweg kann man hier das wildromantische "typische Waldviertel" entdecken.
Anschließend führen die Autoren noch in die nähere Umgebung von Maria Taferl: Der Panoramablick auf die Alpenvorlandkette ist so beeindruckend wie der Vorspann zu einem Heimatfilm. Die weitausladende Kulisse des Donautals lässt tief durchatmen und genießen. Auch die Ansichtskarten "aus der Vogelschau" machen Lust auf einen Besuch.
Das letzte Kapitel ist Utopien von anno dazumal gewidmet. Maria Taferl in der Zukunft wird mit Autos, Bahn und Flugzeugen erschlossen. 1913 hat man humorvoll an eine Zeppelin-Station Maria Taferl gedacht. Damals landete das Luftschiff in Wien und prompt druckte ein findiger Verleger einen "Gruss aus Maria Taferl" mit zwei Passagieren im Korb des Zeppelins, die auf die Wallfahrtskirche herabblicken.