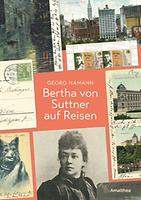Georg Hamann: Bertha von Suttner auf Reisen#
Georg Hamann: Bertha von Suttner auf Reisen. Postkarten an Haushälterin und Hund. Amalthea Signum Verlag Wien. 224 S., ill., € 30,-
Man kennt ihr Portrait von der 2-Euro-Münze und vom alten 1000-Schilling-Schein: Bertha von Suttner (1843-1914). 1905 erhielt sie als erste Frau den Friedensnobelpreis. Georg Hamann nimmt das 120-Jahr-Jubiläum der Verleihung zum Anlass eines Bildbandes, der manchen einen ersten Überblick über Bertha von Suttners Leben und Zeit zu bieten vermag, anderen hingegen eine Ergänzung bereits vorhandenen Wissens. Die Mutter des Autors, die bekannte Historikerin Brigitte Hamann (1940-1916), hatte der Pazifistin eine umfangreiche Biographie gewidmet (Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden, 1986) und Material über sie gesammelt. Darunter eine Schachtel mit Notizbüchern, Fotografien aus Suttners Besitz und vielen Ansichtskarten, die diese von Reisen an ihre Haushälterin schickte. Suttner lässt darin ihren geliebten Hund Putzi grüßen, sie ärgert sich über falsch gepackte Reisetaschen oder freut sich nach üppigen Festbanketten auf eine Schüssel Karfiol. Solche Alltäglichkeiten lassen Suttner als Mensch in den Vordergrund treten.
Die Gräfin Bertha Sophie Felicitas von Suttner wurde im Prager Palais der Fürsten Kinsky geboren. Der Vater war vor ihrer Geburt gestorben. Die Mutter Sophie, geb. von Körner, zog mit der kleinen Tochter und deren Bruder nach Brünn. Bertha, die standesgemäß Französisch, Englisch und Italienisch erlernte, erfreute sich einer unbeschwerten Kindheit. Unseligerweise verspielte die Mutter ihr Vermögen. Komtess Bertha, nun im heiratsfähigen Alter, genoss ihr Leben und teilte "herzhafte Körbe" an Verehrer aus. Während ihre Mutter in der Kurstadt Bad Homburg (D) abermals im Casino hohe Summen verlor, freundete sich die Tochter mit der Fürstin von Migrelien (Georgien) an. Noch immer ledig, suchte die belesene und gut ausgebildete junge Adelige eine Stelle als Gesellschafterin. Sie fand etwas Passendes bei der Familie des Barons Carl von Suttner, dem Besitzer der Zogelsdorfer Steinbrüche in Harmannsdorf im Waldviertel (Niederösterreich) - und verliebte sich unsterblich in dessen Sohn Arthur Gundaccar (1850-1902). Sie heirateten gegen den Willen seiner Eltern, die den Sohn enterbten. Das Verhältnis musste geheim bleiben und Bertha das Haus verlassen. Kurzzeitig arbeitete sie in Paris als Sekretärin des Millionärs Alfred Nobel. Die Liebe zu ihrem Arthur war stärker. Dieser hatte allerdings keine Ausbildung und Schulden.
Mithilfe der Fürstin von Migrelien wollte sich das junge Paar im Kaukasus eine Existenz aufbauen. Der Krieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich erschwerte das Vorhaben. In dieser Zeit, studierte Suttner Bücher, die einen Gesinnungswandel bewirkten, wie Charles Darwins "Entstehung der Arten" oder die optimistische "History of Civilization of England" von Henry Thomas Buckle. Während ihr Mann für die "Neue Freie Presse" in Wien, Novellen und Romane schrieb, veröffentlichte sie - unter Pseudonym - ihr Buch "Inventarium einer Seele" und belieferte Zeitschriften mit Texten, die irritierten. Nach neun Jahren im Orient kehrte das Ehepaar Suttner nach Europa zurück. Man versöhnte sich mit der Familie, deren Vermögen bedenklich geschrumpft war. Mit den Honoraren für ihre Bücher trugen Bertha und Arthur nun zum Familieneinkommen in Harmannsdorf bei. Sie konnten sich auch wieder Auslandsaufenthalte leisten.
In Paris knüpften sie Kontakte zur Internationalen Friedensbewegung. Bertha von Suttner schrieb zwei grundlegende Bücher zu ihrem neuen Lebensthema, 1888 "Maschinenzeitalter" unter dem Pseudonym "Jemand" und ein Jahr später den Roman "Die Waffen nieder" unter ihrem eigenen Namen. Sie fand weltweit Interesse, Anerkennung und auch Ablehnung. Bertha von Suttner war nun schlagartig zu einer berühmten Schriftstellerin geworden. Sie hatte die Gunst der Stunde genutzt und war zur rechten Zeit mit dem rechten Buch ins Rampenlicht getreten. Mithilfe tat- und finanzkräftiger Unterstützer gründete sie 1891 die Österreichische Friedensgesellschaft. Als unermüdlicher Mitarbeiter erwies sich der Berliner Verlagsbuchhändler - und spätere Friedensnobelpreisträger - Alfred Hermann Fried. Der gebürtige Wiener gründete die pazifistische Zeitschrift "Die Waffen nieder!" (dann "Friedenswarte"). Arthur von Suttner engagierte sich in jenen Jahren beim "Verein zur Abwehr des Antisemitismus", dem jedoch kein langer Bestand beschieden war.
Während Bertha von Suttners kometenhaften Aufstieg dümpelte die Karriere ihres Ehemannes träge vor sich hin … Da konnte Bertha hinter seinem Rücken noch so eifrig protegieren und seine Vorzüge und sein Talent preisen - ein ernst zu nehmender Schriftsteller sollte niemals aus ihm werden. Dennoch war sie mit Arthur in unbeirrbarer Liebe verbunden … Sie unternahmen Reisen (z.B. Cote d'Azur, Venedig). Bertha von Suttner war mittlerweile Präsidentin der Österreichischen Friedensgesellschaft, organisierte Konferenzen, Kongresse, hielt Vorträge und pflegte Kontakte zu Kollegen und Sponsoren. Für die literarische Arbeit fehlte ihr die Inspiration, nur ungern produzierte sie "Schmarrn", um Geld für die Familie zu verdienen, die ihr pazifistisches Engagement geringschätzte. Außerdem war eine Ehekrise nicht abzuwenden, seit die Nichte Marie Louise (1873-1948) die Liebschaft mit ihrem 23 Jahre älteren Onkel Arthur 1898 öffentlich machte. (Er starb 1902).
In den 1890 er Jahren reiste Bertha von Suttner kreuz und quer durch Europa … Sie betrieb das, was man heute als Lobbying bezeichnet. So besuchte sie 1891 den Weltfriedenskongress in Rom, 1899 die Haager Friedenskonferenz, 1900 Fürst Albert I. von Monaco, hielt Vortragstourneen durch Deutschland oder kurte in Karlsbad. Hier kommen nun die im Untertitel des Buches genannten Postkarten an Haushälterin und Hund ins Spiel. Nach dem Verlust des Familienschlosses Harmannsdorf übersiedelte Suttner nach Wien, die treue Haushälterin Katharina Buchinger und der Spitz Putzi kamen mit. Dem weißen Hund "mit ruppigem Charakter" schickte die Baronin Ansichtskarten oder zumindest Grüße. Sie schrieb ihm u.a. ein Lied ("Wutzerle, der Wutzerle, der Wutzerle wu wu…")
1904 bereiste die Pazifistin erstmals die USA, betätigte sich - in englischer und französischer Sprache - beim Weltkongress in Boston als eifrige Rednerin, fand Kontakt zu Präsident Theodore Roosevelt und zur Internationalen Frauenkonferenz. So wichtig es war, die Friedensaktivitäten für die berechtigten Anliegen der Frauenrechtlerinnen zu sensibilisieren, so sollten umgekehrt letztere auch für die Friedensarbeit gewonnen werden, kommentiert Georg Hamann ihre Bestrebungen. 1912 brach Suttner "zu einer regelrechten Tour de Force" erneut in die USA auf. Innerhalb eines halben Jahres sprach sie in 16 Bundesstaaten, u.a. in Los Angeles, Pasadena, Chicago, Philadelphia und New York. Die Menschen strömten zu Tausenden zusammen, wenn der berühmte Gast aus Österreich über Frauenrechte und Friedensbewegung dozierte. … Insgesamt dürften es mehr als 100.000 Menschen gewesen sein, die sie während ihres USA-Aufenthalts erleben durften. … Wo immer sie auftauchte, waren die Säle ausverkauft, was die Reise nicht zuletzt finanziell lohnenswert machte. Zu Weihnachten 1912 war die inzwischen fast 70-Jährige zurück im "schandbaren Mittelalterlande" Österreich. Inzwischen war "die große Zeit der europäischen Friedensbewegung zu Ende" gegangen. Der Erste Weltkrieg kündigte sich an. Suttners letzte Jahren waren von Enttäuschungen geprägt und sie musste sich letztlich eingestehen, auf ganzer Linie gescheitert zu sein.
Den von ihr angeregten, von ihrem Förderer Alfred Nobel gestifteten Friedenspreis erhielt sie vorerst nicht, sondern erst 1905. Knapp ein Jahrzehnt konnte sie sich daran erfreuen. Bertha von Suttner starb am 21. Juni 1914. Genau eine Woche später erfolgte das Attentat auf Thronfolger Franz Ferdinand. Am 24. Juli begann der erste Weltkrieg. Er kostete 17 Millionen Menschen das Leben.