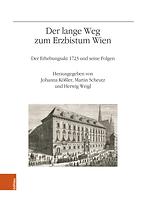Johanna Kößler, Martin Scheutz, Herwig Weigl (Hg.): Der lange Weg zum Erzbistum Wien #
Johanna Kößler, Martin Scheutz, Herwig Weigl (Hg.): Der lange Weg zum Erzbistum Wien. Der Erhebungsakt 1723 und seine Folgen. Verlag Böhlau Wien. 376 S., ill., € 50,-
Seit 1723 ist Wien ein Erzbistum. Das 300-Jahr-Jubiläum war Anlass einer wissenschaftlichen Tagung im Curhaus. Auf Initiative des Diözesanarchivs entwickelte sich eine produktive Zusammenarbeit mit dem Wiener Stadt- und Landesarchiv und dem Verein für Geschichte der Stadt Wien. Nun liegt der Tagungsband vor, er ist bereits der 80. Band der Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Dessen Mitglieder Univ. Prof. Dr. Martin Scheutz und Ass. Prof. Dr. Herwig Weigl bilden, gemeinsam mit Mag. Dr. Johanna Kößler, der Leiterin des Erzbischöflichen Diözesanarchivs, das Herausgeberteam der anspruchsvollen Publikation. Fünfzehn Beiträge untersuchen "Voraussetzungen und Auswirkungen dieser Rangerhöhung. Sie behandeln Fragen des Kirchenrechts, des Zeremoniells und des Verhältnisses zum Kaiserhof und den Betroffenen, dem Erzbistum Salzburg und dem Bistum Passau. Das kulturelle Ambiente kommt in Forschungen zur Bau- und Ausstattungsgeschichte der Bischofsresidenz und des Stephansdoms, zu Predigten, der Festmesse, den Grablegen der Oberhirten und zur quellenkundlichen Basis im Diözesanarchiv mit den Erhebungsurkunden zum Tragen, bevor Bemühungen der Selbstbehauptung der Wiener Kirche gegenüber Protestantismus, Säkularisierung und Glaubensverlust in jüngerer Zeit angesprochen werden."
Wien war seit 1469 Amts- und Gerichtsbezirk eines Bischofs. Das exemte (von bestimmten gesetzlichen Pflichten und Verbindlichkeiten befreite) Bistum umfasste drei Stadt- und 14 Landpfarreien. Bis zur Erhebung zum Erzbistum sollten mehr als zweieinhalb Jahrhunderte vergehen. Renate Kohn vom Institut für Mittelalterforschung schreibt: "Die winzige Diözese war nicht dazu geeignet, einem Wiener Bischof das seinem Amt an sich zustehende Prestige zu verleihen; die unzureichende Dotierung hinderte ihn an einer angemessenen Amts- und Lebensführung … (Die Wiener Oberhirten) waren so etwas … wie 'Nebenerwerbs-Bischöfe'. … Diese suboptimale Ausgangssituation führte dazu, dass die Wiener Kirche der … Reformation und der folgenden Glaubensspaltung lange Zeit hindurch nicht angemessen begegnen konnte. "
Der erste Wiener Fürsterzbischof Sigismund Graf Kollonitz (1677-1751) verfasste 1736 ein zorniges Sittenbild – "Gravamina" – gegen die Protestanten. In sieben Punkten rügte er dem Kaiser gegenüber die Missstände: Protestantenboom, Mangel an zünftischer Kontrolle, Widerspenstige Prediger, Überdehnung diplomatischer Freiheiten. Sabotage am Sterbebett, Verführerische Bücher und Glaubenskrise. In eindrucksvoller Weise setzt sich der Politikwissenschaftler Stephan Steiner mit dem Beschwerdeschreiben auseinander.
Ein Hindernis auf dem langen Weg zum Erzbistum Wien war die "schwierige Dreiecksbeziehung" zwischen Salzburg, Passau und Wien, über die Gerald Hirtner referiert. Der Archivar der Erzabtei St. Peter zeigt: "Die Gegensätze zwischen der Diözese Passau und der Erzdiözese Salzburg gehen bis in das 10. Jahrhundert zurück, als Bischof Pilgrim von Passau mithilfe von Urkundenfälschungen versuchte, neue Tatsachen zu schaffen. In der Hoffnung, die Metropolitanwürde zu erlangen. … Um 1720 konnte Passau seine Interessen gegenüber Salzburg durchsetzen, musste aber Zugeständnisse an Wien machen. "Die Erhebung Wiens zum Erzbistum war jedenfalls eine Angleichung an die realpolitischen Gegebenheiten einer Haupt- und Residenzstadt."
Auch Hannelore Putz vom Archiv des Bistums Passau beschäftigt die "spannungsreiche Beziehung der beiden Städte. "Am 24. Februar 1723 , dem Festtag des Apostels Matthias, war es endlich so weit. Nach jahrzehntelangen zähen Verhandlungen, Auseinandersetzungen, diplomatischen Winkelzügen und unter Aufbietung allen kaiserlichen Einflusses und kaiserlicher Macht feiert Wien die Übergabe des Palliums an den nunmehrigen Erzbischof Sigismund Graf Kollonitz und den damit verbundenen Aufstieg des Bistums zum Metropolitansitz. … Das junge Tochterbistum Wien übertraf damit das alte Mutterbistum Passau an Rang und Würde. … (Passau) gehörte zu den kleinen Residenzstädten des Reichs. Wien dagegen war schon lange zur europäischen Metropole aufgestiegen." Die Feierlichkeiten ließen an Sollenität nichts zu wünschen übrig. Der Band gibt einen lebendigen Eindruck in barockes Zeremoniell, Repräsentation und Performanz, was die Texte kulturhistorisch interessant macht.
Die Geschichte des Pfarrhofs von St. Stephan reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück, wie die Denkmalforscher Günther Buchinger und Doris Schön erläutern. Nach Zerstörungen erfolgte im 13. Jahrhundert ein palastartiger Neubau, der bis ins 17. Jahrhundert teilweise bestand. Untersuchungen bestätigten die Entstehung des Sparrendachs 1637/38. Fürstbischof Philipp Christoph Graf Breuner (1597-1669) legte eine Sammlung von Kunstwerken und Raritäten sowie eine Bibliothek mit 3000 Bänden an. "Der Neubau des bischöflichen Palais mit Kapelle, Galerie sowie zahlreichen stuckierten Sälen und Räumen mit Tapisserien ist als wichtigster Wiener Palastbau aus den 1630 er Jahren zu bezeichnen", schreiben die Denkmalforscher.
Mit dem Amtsantritt von Fürstbischof Breuner setzte auch die Barockisierung des Stephansdoms ein, "die den Dom einer massiven, gegenreformatorisch geprägten Neuausstattung unterzog", wie die Kunsthistorikerin Anna Mader-Kratky formuliert. Die Umbauten begannen im Presbyterium. Der Vertrag des Fürstbischofs mit dem Bildhauer Johann Jakob Pock für einen neuen Hochaltar aus schwarzem Marmor datiert aus 1641. Die Altarweihe erfolgte sechs Jahre später. Mittelalterliche Fenster wurden durch helle Scheiben ersetzt, marmorne Sakristeiportale und ein geschnitztes Chorgestühl, eine Musikempore und ein kaiserliches Oratorium errichtet. Privatpersonen stifteten rund 40 Pfeiler- und Seitenaltäre – vom Peter- und Paul-Altar (1677) bis zum Dreifaltigkeitsaltar (1751). Obwohl man diese während der Josephinischen Reformen und im Sinne der Regotisierung als "höchst unzweckmäßig" tadelte, blieben fast alle erhalten. Für den "konservatorischen Weg" fand der Architekt Adolf Loos lobende Worte, "wenn er St. Stephan als den 'weihevollsten kirchenraum der welt' bezeichnete."
Mit der jüngeren Vergangenheit beschäftigt sich Rupert Klieber vom Institut für Historische Theologie der Universität Wien. Er sieht das Erzbistum Wien im 19. und 20. Jahrhundert "zwischen Aufbrüchen, Umbrüchen und Abbrüchen". Inzwischen zählte es zu den größten Diözesen Europas. Der Autor konstatiert drei Phasen von je rund sieben Dekaden: Die erste (1820-1895) war "geprägt durch eine von Hof, Adel und Initiativen der Basis geförderte Restauration traditioneller Kirchlichkeit". Die zweite Phase sieht er "gekennzeichnet durch ein beherztes Streben nach gesellschaftlicher Hegemonie zwischen 1895 und 1970, unterbrochen von einer Zwangspause in der NS-Zeit". Phase III nennt er "bestimmt vom Richtungskämpfen im Kontext eines rapiden Bedeutungsverlustes von Religion und Kirchen aufgrund eines 'Kulturklimawandels' ab 1970 – mit offenem Ausgang."
Das wissenschaftliche Werk, das zahlreiche Detailstudien vereint, hat darüber hinaus großen Nutzen für die breitere Öffentlichkeit. Durch die Zusammenarbeit des Diözesanarchivs mit dem Wiener Stadt- und Landesarchiv und dem Verein für Geschichte der Stadt Wien erfolgte die Überarbeitung einschlägiger Themen im Wien-Geschichte-Wiki, dem umfassendsten lexikalischen Web-Angebot zur Wiener Stadtgeschichte.