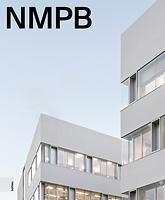Markus Kristan: NMPB-Architekten. Angemessen und Nachhaltig#
Markus Kristan: NMPB-Architekten. Angemessen und Nachhaltig. Verlag Böhlau Wien. 232 S. ill., € 55,-
Viele markante Objekte - Schulen, Universitätsbauten, Bürogebäude und Wohnhäuser stammen von NMPB-Architekten. 1970 gründeten Manfred Nehrer und Reinhard Medek (1944-2003) in Wien das Büro Nehrer+Medek. Beide schlossen 1967 das Studium der Architektur an der Technischen Hochschule Wien ab. 1993 wurden Herbert Pohl und 2004 Sascha Bradic Partner. Seitdem heißt das Büro Nehrer Medek† Pohl Bradic – NMPB-Architekten.
Der Kunsthistoriker und Architekturkritiker Markus Kristan widmete den Arbeiten der letzten zwei Jahrzehnte eine repräsentative Dokumentation, die neben großformatigen Fotos Texte von Architekturkritikern enthält. Im Berichtszeitraum entstanden rund zwei Dutzend Objekte. Das Werkverzeichnis weist ein Mehrfaches an nicht realisierten Wettbewerbsentwürfen, die meisten davon prämiert, auf. Für das Buch hat Markus Kristan 23 Projekte aus beiden Gruppen ausgewählt.
Der "gedachte Spaziergang" beginnt bei der Universitätszahnklinik, die "seit ihrer Eröffnung 2013 vielleicht zu einem der prominentesten Bauten der NMPB-Architekten geworden" ist. Voran gingen zwei Wettbewerbe 1993 und 1999, der Bau startete 2008. "Die Aufgabe war, das 1783-85 von dem französischen Architekten Isidor Ganneval im Auftrag Kaiser Joseph II. errichtete, um zwei Höfe gruppierte Garnisonsspital in eine moderne Zahnklinik umzubauen und dahingehend auch unter Berücksichtigung der Auflagen des Denkmalschutzes zu erweitern. … Dies ist ein vorbildhaftes Beispiel für sorgsamen Umgang mit alter Bausubstanz, ohne deshalb auf moderne Architektur verzichten zu müssen. … Dem Bauherrn war es wichtig, im Gebäudeinneren kein "weißes", den Patienten abschreckendes Spital zu haben." Canevales großzügiges Konzept erlaubte nach nahezu einem Vierteljahrtausend Flexibilät und Nachhaltigkeit. Man betritt die Klinik nun in der Sensengasse und gelangt in die hohe, lichtdurchflutete Eingangshalle. Das Farbkonzept ihrer Wände wirkt fröhlich und "angsthemmend." Die neue Zahnklinik enthält Ausbildungs-und Ordinationsräume (drei Säle mit je 26 Behandlungsplätzen), den Festsaal der Universität Wien, Bibliothek, Hörsäle, Cafeteria und Kindergarten. Die Planung nahm besonders auf die Umgebung Bedacht. Durch Aufwertung des Kräuterhofs und Garnisonhofs entstanden neue Durchgänge und Grünräume. Ein Fußweg in Nord-Süd-Richtung führt zum Uni-Campus AKH, einer Ost-West-Richtung zum Institutsgebäude Währinger Straße 29.
"Der Hauptzugang zum neuen Institutsgebäude erfolgt durch eine großzügige Halle mit Durchblick in den zentralen Innenhof. Die Halle erschließt das Hörsaalzentrum im Untergeschoß, die Bibliothek und Zugänge zu den Instituten in den Obergeschoßen", schreibt Markus Kristan über den Bau in der Währinger Straße 29. Jan Tabor übertitelte sein Kapitel darüber "Noblesse und Pragmatismus". Er zeigt, wie die Planer "ein brillantes architektonisches Spiel mit der anspruchsvollen Umgebung spielen … Mit bewundernswertem Erfolg!" Auch Christian Kühn lobt das "Stadthaus mit Buckeln", dessen Fassadenelemente das Licht unterschiedlich reflektieren. "Das Gebäude wurde unter maximaler Ausnutzung der Bebauungsbestimmungen auf das Grundstück gesetzt. Es füllt die Baulücke zur Währinger Straße mit einem bis zu achtgeschoßigen Trakt aus, ein zweiter Trakt in derselben Höhe schließt an der südlichen Grundgrenze L-förmig an. Durch seine Höhe unterliegt das Gebäude bereits den Bestimmungen für Hochhäuser … Es ist umso bemerkenswerter, dass das Gebäude im geplanten Kosten- und Zeitrahmen errichtet wurde." Das gilt auch für die Technische Universität Wien, an der Nehrer und Medek einst ihr Architekturstudium absolvierten. 2012 stand die Sanierung des Gebäudes mit acht Trakten, die barrierefreie Erschließung und die Schaffung neuer Räume an. Spektakuläres Highlight ist der Kuppelsaal im Dach des Mittelrisalits. Die mächtige Balkendeckenkonstruktion bildet einen Veranstaltungssaal, dessen Akustik bei Konzerten geschätzt wird. Die Architekten sehen in der Freilegung der beeindruckenden historischen Holzkonstruktion eine ihrer wichtigsten Arbeiten.
In nächster Nähe erwartete sie ein weiteres Revitalisierungsprojekt. 2013/14 verwandelten sie den barocken Gebäudekomplex des Theresianums - Gymnasium mit Internat - zu einem Bildungscampus mit Volksschule und Kindergarten. Ganz anders verhielt es sich bei der Fachhochschule Sankt Pölten. Hier konnte 2005 bis 2007 und 2016 bis 2021 "auf der grünen Wiese", in einer unstrukturierten Gegend nördlich vom Zentrum der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebaut werden. "Tiefe, großzügig bemessene Einschnitte in die beiden über nahezu quadratischem Grundriss errichteten Baublöcke sowie jeweils ein weiträumiger Lichthof schaffen im Gebäudeinneren lichtdurchflutete Hallen, die wiederum gute, wohltuend schnelle und einfache Orientierbarkeit ermöglichen." Weitere moderne Bildungseinrichtungen entstanden im Schulzentrum Krems (NÖ), Schulcampus Monte Laa und Volksschule Eßling. (Noch ?) nicht ausgeführt wurde das futuristisch anmutende Preisträger-Projekt eines geladenen Wettbewerbs für das Hans-Sachs-Gymnasium mit Sporthalle in Nürnberg (D). Zu den realisierten öffentlichen Bauten zählen die Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien 4, das Bürgerzentrum Böheimkirchen (NÖ), die Rettungs-und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch (Vorarlberg).
Der richtige Einsatz von Materialien, innovative Konstruktionen und sparsamer Umgang mit Ressourcen als bestimmende Faktoren werden auch im Wohnbau deutlich. Die Projekte haben eine starke Beziehung zu ihrem Umfeld. In der "Gartensiedlung Ottakring", Wien 16, besteht dieses aus Gründerzeithäusern und der Brauerei. Beim "Wohnquartier Wilhelm-Kaserne", Wien 2, erhielten NMPB-Architekten den 1. Preis bei einem EU-weiten Wettbewerb, der die Grundlage für den Masterplan bildete. An der "Wohnpartitur Süßenbrunner Straße West", Wien 22, wird noch gearbeitet. Wie bei den anderen Projekten sollen großzügige grüne Flächen, Terrassen und Vorhöfe Räume des sozialen Austauschs bilden. "Wohnen für Generationen Ottakring", Wien 16, umgibt das Landhaus Jenamy, ein Frühwerk des Biedermeier-Architekten Joseph Kornhäusel. Es wurde mit einem geschwungenen niedrigen Baukörper freigestellt, der die Verbindung zur angrenzenden aufgelockerten Bebauung im ehemaligen Vorort schafft. In peripherer Lage entstand der Wohnbau "Drei Schwestern". Er ist Teil des Stadtentwicklungsgebiets Seestadt Aspern, Wien 22, dessen Grünanteil bei 50 % liegt. Mit 69 Wohnungen wurde ein neues Finanzierungsmodell erprobt, bei dem ein m² Nutzfläche nur 1260 € kosten darf. Der "Barbara-Prammer-Hof", Wien 10, ist der erste "Gemeindebau neu". Seit 2004 errichtet die Stadt geförderten Wohnbau nur noch über gemeinnützige Bauträger. Gedeckelte Baukosten und kleinere Wohnungen ermöglichen günstige Mieten. Hier bilden drei Innenhöfe das Herz der Anlage. Die kompakten Wohnungen verschiedener Typen verfügen über Balkon oder Loggia. Christian Kühn schrieb in der "Presse" von einer "hervorragenden Lösung, an der sich der Gemeindebau neu zu messen haben wird." Etwa gleichzeitig entstand das Wohnquartier "Wohnen am Mühlbachquartier" in St. Pölten (NÖ), wobei die Bildung von Gemeinschaften als elementares Thema galt. Gärten, Wiesen und "Platzl" , die zum Verweilen einladen, schaffen Identität und Orientierung.
Auch hier gilt: "Die Architektur von NMPB-Architekten wird …von Begriffen wie Angemessenheit, Nachhaltigkeit, Großzügigkeit, Flexibilität, Noblesse und Pragmatismus geleitet. … Das jeweils individuelle und angemessene Konzept wird bis in jede Einzelheit verfolgt. Die Lösung einer Bauaufgabe ist niemals eine Frage von Stil, sondern immer Ausdruck einer Haltung und einer Architektur-Philosophie!"