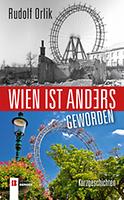Rudolf Orlik: Wien ist anders geworden#
Rudolf Orlik: Wien ist anders geworden. Verlag Berger Horn. 244 S., € 19,90
In den 1980er Jahren entdeckten die historischen Wissenschaften die "Geschichte von unten". Ob Knecht oder Universitätsprofessor - viele Menschen schrieben ihre Lebenserinnerungen. Nicht die "große" Geschichte, sondern der Alltag und die persönlichen Erfahrungen standen im Mittelpunkt. Der "Opernführer" Marcel Prawy meinte einmal: Wenn jemand nichts mehr ist, ist er immer noch Zeitzeuge. Inzwischen scheint die "Ego historie"-Welle abgeebbt, doch gibt es interessante Neuerscheinungen. So zog in den Corona-Jahren der gelernte Zuckerbäcker und spätere Versicherungsberater Rudolf Orlik, Jahrgang 1942, seine Wien-Bilanz. Er beschreibt den "Fluss der Zeit vom Jahr 1945 bis heute". Jetzt erschienen seine Kurzgeschichten unter dem vielsagenden Titel Wien ist anders geworden.
Der Autor bezeichnet sich als "skeptischer Optimist, der das Schlimmste befürchtet und das Beste erwartet." Er zieht seine Vergleiche als begeisterter Wiener, der seine Stadt liebt und den Wandel der letzten acht Jahrzehnte "nüchtern, aber in launiger Art" beschreibt. Älteren LeserInnen wird vieles bekannt vorkommen, was jüngeren seltsam erscheint, wie offene Straßenbahnwaggons, Sonntagsgewand oder Vierteltelefon. Mehr als 30 Themen hat Rudolf Orlik zusammengestellt und beginnt mit der Stadt: Das Erscheinungsbild der Innenstadt Wiens hat sich von einem hässlichen, zerzausten Entlein im Jahr 1945 zu einem schönen Schwan in den heutigen Tagen entwickelt. Das zweite Kapitel widmet er den Menschen: Natürlich wird eine Stadt erst mit ihren Einwohnern zu einem lebenden Organismus. Sie sind das Herz und das Leben. … Seit dem Weltkrieg sind schon drei Generationen Wiener groß geworden, haben aufgebaut, gearbeitet und gelebt. In nun mehr als siebzig Jahren nach Kriegsende hat sich auch der typische Wiener stark verändert, oder auch nicht. In diesem Widerspruch liegt auch die Erkenntnis, dass Wien immer von einem Völkergemisch bewohnt war, nur die Zusammensetzung hat sich geändert.
Ebenso wurden die Berufe andere. Während die Programmierer in der Berufsrangliste zu gut bezahlten "göttergleichen Wesen" aufstiegen, sank der Stern eines 500 Jahre alten Berufes, wie der des Buchdruckers, der dem einfachen, schnelleren und billigeren Computerdruck weichen musste. Wenn sich jetzt jedes Kind mit Computern beschäftigt, sei es ist nur mehr eine Frage der Zeit, wann der Programmierer das Schicksal des Buchdruckers teilen wird und sich um einen neuen Beruf umschauen müsse.
Massenmedien wie das Fernsehen greifen in die Sprache ein: Ausdrücke wie lecker, hochgehen, Sohnemann, Tunke und andere norddeutsche Sprachgebilde verdrängen die weichen Wiener Ausdrücke gut, hinaufgehen, Sohn und Sauce. Früher war das Radio das beliebteste Massenmedium. Der Autor erinnert sich an die sogenannte Erbschleichersendung "Ein Gruß an dich", die daheim lief, als er die Hausaufgaben machte und die einen musikalischen Geschmack beeinflusste. "Autofahrer unterwegs" oder "Die große Chance" mit Maxi Böhm prägten sich ein.
Es wäre nicht Wien, ohne Reminiszenzen an die Heurigenbesuche der Familie, die am Sonntag mit Schnitzel und Gurkerl in der Proviantdose aus Aluminium und Erdäpfelsalat im Marmeladeglas in den Wienerwald führten. Ein anderes Vergnügen waren Ausflüge zum Überschwemmungsbiet, Vorläufer der Donauinsel. Dort herrschte Volksfeststimmung, denn außer Sport und Sonnenbaden gab es ein spezielles Glücksspiel, bei dem man Lose für Warenpreise kaufen konnte. Diese waren Küchengeräte, Fahrräder, Gutscheine für Kleiderhäuser, sogar Motorräder und ein Auto. Der Ausrufer pries die Waren und plauderte mit den glücklichen Gewinnern. Es gab Musik, Wein, Bier und Limonade, Würstel und Schokolade. Die Lotterie im Überschwemmungsgebiet hatte sich schon vor dem Bau der Donauinsel überlebt. Beim Inselfest zu Schulschluss ist diese Schauplatz der größten Freiluftparty Europas.
Eine besondere Rolle spielten für den Autor Einkäufe und Märkte. Sein Großvater, der aus der Slowakei nach Wien gekommen war, bezog die Waren für sein Obst- und Gemüsegeschäft auf dem Naschmarkt. Vor der Eröffnung des Großmarkts in Inzersdorf zogen die Kleinhändler um 3 Uhr Früh mit hölzernen Handwagen auf den Naschmarkt, um bei Marktbeginn um 4 Uhr die frischeste und günstigste Ware zu ergattern. Das tröstliche Leitmotiv der persönlich erlebten Stadtgeschichte ist für Rudolf Orlik Panta rhei - alles fließt. Mit Ausnahme des Stadtverkehrs, wie er anmerkt.
In der Stunde null waren außer fremden Soldaten, zerstörten Panzern, weggeworfenen Gewehren, ausgebrannten Lastwagen und einigen ramponierten Personenautos die Straßen gespenstisch leer. Das änderte sich in Wiederaufbaujahren. Die Jugend Wiens packte der Autovirus, alle wollten Mechaniker werden und natürlich auch ein Auto haben. Autoverwertungsfirmen wie "Metzker" verkauften gebrauchte PKW-Teile, aus denen man sein Fahrzeug zusammenbasteln konnte. Manche Autoverkäufer agierten wie Rosstäuscher und machten aus rostigen Vehikeln mit munteren Reden rassige Gefährte. Doch nach einigen Tagen zeigte sich: Auto hin, Geld weg und wollte man sich beschweren, war der Händler auch weg.
Schleichend wurde Wien zur Autostadt. … Der Wohlstand wuchs, die Autos wurden immer größer. … Als nun endlich alle Abstellflächen mit Erst-, Zweit- und Drittautos besetzt waren, … kam die Parkraumbewirtschaftung, was besser klang als Parkplatzsteuer und eine sprudelnde Einnahmequelle für die Stadtverwaltung wurde. Als neuer Beruf entstand der Parksheriff, dessen Image sich in der Beliebtheitsskala auf Kellerniveau befinde, wie der Autor beobachtete und kritisch anmerkt: Was vorher eine Fortbewegung von A nach B war, wurde eine Todsünde an der Natur. Die Schützer der Umwelt traten militant in allen Medien auf, verteufelten das Autofahren und forderten Buße in Form von Verzicht auf Ausfahrten. Dabei vergaßen sie, dass das Aussterben der Nahversorger größere Einkäufe ohne Auto verunmöglichte.
Rudolf Orlik beschreibt die Veränderungen aus persönlicher Perspektive und achtet darauf, dass die eigene Meinung nicht zu stark in das Manuskript einfließt. Er macht sich u.a. Gedanken über Massenmedien, Telefon, Tanzveranstaltungen, die Kirche, Banken, Schulen, Hausmeister, Post, Parks, Polizei, Kino, Mode, Politik, Straßenbahn, "Vom Wirtshaus zum Nobelrestaurant", "Aus Burg und Oper", Spitäler und Vereine. Sein Fazit: Wien ist anders. Das ist keine gefährliche Drohung, sondern ein Faktum.