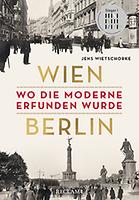Jens Wietschorke: Wien - Berlin#
Jens Wietschorke: Wien - Berlin. Wo die Moderne erfunden wurde. Reclam Verlag Ditzingen. 345 S., ill., € 26,80
Dieses perfekte "Wissenschaftsbuch des Jahres 2024" muss man gelesen haben. Zugleich fundiert und spannend, beleuchtet es die Hassliebe zweier kultureller Antipoden. Der Autor kennt sie beide. Als Kulturwissenschaftler zeichnet er ein differenziertes und ausgewogenes Bild. Solche Bücher gibt es selten.
PD Dr. Jens Wietschorke studierte Europäische Ethnologie, deutsche Literatur und Philosophie in Tübingen, Wien und Berlin, wo er 2009 promoviert wurde. Anschließend wirkte er als Universitätsassistent und stv. Institutsvorstand am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Nach der Habilitation wurde er akademischer Rat am Institut für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Danach wieder einige Jahre in Wien tätig, übernahm Jens Wietschorke eine Professur in Tübingen und lehrt nun wieder in München. 2010 war es für ihn ein "Abenteuer", von Berlin nach Wien zu übersiedeln und 13 Jahre später wusste er, dass der Abschied schwerfallen würde.
Sein Buch über die Erfindung der Moderne in den beiden Städten beginnt der Autor mit einem Vergleich aus der Festkörperphysik: Magnete sind Körper, die sich gegenseitig anziehen oder abstoßen. Zwischen ihnen liegt ein Magnetfeld. Solche gibt es auch zwischen Menschen und Biographien, sozialen Milieus, kulturellen Phänomenen und Städten. Wien und Berlin verbindet eine ausgesprochen intensive Anziehungs- und Abstoßungsgeschichte. Die Konkurrenz der Residenzstädte geht bis in die frühe Neuzeit zurück und erreichte in den 1870er bis 1930er Jahren ihren Höhepunkt. Der Wiener Nobelpreisträger Alfred H. Fried meinte in seinem 1908 publizierten Buch "Wien - Berlin. Ein Vergleich", dass "ein Vergleich dieser beiden Städte mit dem Mars näher läge als ein Vergleich untereinander" .
Jens Wietschorke kommentiert: Während Wien als Stadt 'uralter Vornehmheit' und tief eingeprägter Geschichtlichkeit verstanden wurde, erschien Berlin als Parvenü unter den Metropolen, als geschichtslose Kolonialstadt. In acht überaus aufschlussreichen Kapiteln beschreibt der Autor "Klischees". Das Wort kommt aus der Fachsprache der Buchdrucker und bezeichnet einen Druckstock, mit dem sich zahlreiche Kopien herstellen lassen. Im übertragenen Sinn meint es auch Vorurteile und folkloristische Zuschreibungen. Was erzählt wird, stimmt nur halb, die andere Hälfte ist falsch. So nehmen Klischees eine Zwischenstellung zwischen Realität und Fiktion ein, sind erfundene Wahrheiten und wahre Erfindungen, die geglaubt werden.
Bedeutende Schriftsteller trugen dazu bei. Friedrich Schiller sprach von den Wienern als "Phäaken", sorgenfrei dahinlebenden Leuten, die es sich immer gut gehen lassen. Nicht nur mit dem Blick von außen bietet sich dieses Bild. Der Wiener Dramatiker und Archivdirektor Franz Grillparzer rügte seine Heimatstadt als "Capua der Geister", wobei Capua in der Antike als Ort der Verweichlichung und la dolce vita galt. Berlin hingegen erhielt das Attribut "Spree-Athen", die Stadt der Rationalität, der Innovationen in Militär und Verwaltung. Einerseits das barocke, katholische und üppige Wien, andererseits das klassizistisch gestaltete protestantische Berlin, in dem die Disziplin regiert.
Die Landschaft wurde gegensätzlich beschrieben und daraus auf den Charakter der BewohnerInnen geschlossen: Berlin als "Stadt ohne Landschaft", als Konglomerat aus "Orten ohne Eigenart". Adalbert Stifter, Schriftsteller und Maler, porträtierte Wien hingegen als "Stadt, die aus der Landschaft herauswächst" Der Raum wird zum Schicksal folgert Wietschorke.
Das vierte Kapitel übertitelt er Berliner Tempo und Wiener Gemüt. Berlin galt als "schnellste Stadt der Welt", in der sich Kommunikationstechnik, Verkehr und Industrie rapid entwickelten. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain nannte Berlin das "europäische Chicago". Für Kunstkritiker war das kein positiver Vergleich. Viel Zivilisation, wenig Kultur, Hektik statt Konzentration, Quantität statt Qualität. In Wien stellten Beobachter eine "Atmosphäre des Zerfalls" und der Stagnation fest. Da half auch die Weltausstellung 1873 nichts. Sie in endete in einem globalen Börsenkrach.
Im 1. Weltkrieg versuchten die Kulturhistoriker Willi Handl (Wien) und Julius Bab (Berlin), Wien und Berlin zu zwei gleichberechtigten Polen eines neuen Deutschland zu erklären: "österreichische Natur und preußischer Geist". In den "goldenen Zwanzigerjahren" war Berlin für seine Dekadenz bekannt. In der "provinziell gewordenen Hauptstadt" Wien regierten die Sozialdemokraten. Sie blieb, so der Autor, eine durch und durch 'rote' Stadt. Obwohl sich die beiden Städte nach dem 1. Weltkrieg so unterschiedlich entwickelten war das Thema Wien - Berlin in den 1920er Jahren so populär wie nie zuvor. … Das Spiel mit den Städteklischees eignete sich bestens, um politische Zeitkritik im Plauderton zu liefern.
Traditionell war Wien stets die bedeutendste Musikstadt im deutschsprachigen Raum gewesen … auch um die Jahrhundertwende lebten und arbeiteten dort bedeutende Komponisten und Dirigenten … Die Aura der Musikstadt Wien wirkte auf zahlreiche Musiker aus dem Norden überaus anziehend. Andererseits übersiedelten Musikschaffende und Literaten nach Berlin, wie Ernst Krenek, der sich aber mit der Stadt und ihrer Atmosphäre nie anfreunden konnte. Robert Musil, der in seinem zweibändigen Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" die k.u.k. Monarchie literarisch verewigte, machte die ersten Skizzen dazu während seines Philosophie-Studiums in Berlin, das er als "Stadt ohne Eigenschaften" erlebte.
In der literarischen Szene kündigte sich im Fin de Siecle ein Generationenwechsel an. Der Wiener Schriftsteller Hermann Bahr übersiedelte optimistisch nach Berlin - und ließ sich schon ein Jahr später in Wien nieder. Mit einigem Recht kann man in Bahrs städteübergreifendem Engagement für die Erneuerung der Literatur also eine Erfindung der Moderne sehen. … Es sollte eine wienerische Moderne sein: eine Moderne mit Geschmack, Leichtigkeit und Grazie … und die von Bahr propagierte Wiener Moderne begann Berlin zu erobern, schreibt Wietschorke und nennt bekannte Namen wie Arthur Schnitzler, Max Reinhardt - "ein Vermittler zwischen Traum und Wirklichkeit" - Lotte Lenya oder Leo Slezak.
Das abschließende Kapitel nennt der Autor Transformationen einer Städtekonkurrenz. Er beleuchtet die Zeit des Nationalsozialismus, wobei Gauleiter Joseph Goebbels Berlin "nicht ausstehen" konnte und Adolf Hitler "weder für Wien noch für Berlin besonders viel übrig" hatte. Am Ende des 2. Weltkriegs blieb in Berlin nur ein Viertel der Wohnungen blieb intakt. In Wien wurde ein Fünftel der Häuser zerstört. Wien lag aus westeuropäischer Perspektive im Abseits. Berlin wurde zu einer geteilten Stadt, "einer politisch und ideologisch zerrissenen Metropole." Noch 2020 konnte man im Internet lesen: Während Wien eher für Tradition steht, hat Berlin einen cooleren, lockereren Ruf. Zusammenfassend gilt: Die Wirklichkeit der Städte ist viel zu komplex, um in ein paar Begriffen und vermeintlichen Traditionen aufzugehen. … Es sind die Menschen, die die Unterschiede zwischen Städten hervorbringen, indem sie Geschichten und Erzählungen daraus machen. … Es wäre aber nicht die schlechteste Schlussfolgerung aus ein paar hundert Jahren Beziehungsgeschichte, dass man auf irgendeine Weise immer beides braucht: Wien und Berlin.