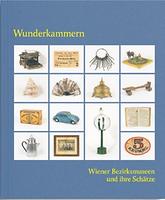Wunderkammern#
Wunderkammern. Wiener Bezirksmuseen und ihre Schätze. Herausgegeben vom Wien Museum. Texte: Regina Wonisch, Fotos: Klaus Pichler. 198 S. ill., € 25,-
"Feuerwehrhelm, Auerochsenhorn und Spinnrad", charakterisierte ein Museumsleiter vor Jahrzehnten ironisch die "Grundausstattung" eines Heimatmuseums. Sie finden sich auch heute noch in den Wiener Bezirksmuseen. Die kleinen Museen sind eine Spezialität der großen Stadt. Es gibt sie in jedem Bezirk, dazu mehrere Sammlungen zu Spezialthemen. Die Wiener Bezirksmuseen werden ehrenamtlich geleitet und betrieben - was oft im Gegensatz zur Wissenschaft steht. Detailliertes Wissen und "Herzblut" zeichnen sie aus, und das macht manche Defizite wett. In einer weltweit einzigartigen Tradition wirken die Bezirksmuseen als Orte der Begegnung und der lokalen Wissensvermittlung; vor allem aber sind sie identitätsstiftende und soziale Räume, schreibt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler im Vorwort zu diesem interessanten Fotoband. Er ist eine Art verspätetes Geschenk zum 100. Geburtstag der Museen, 2023.
Nach dem Ende der Donaumonarchie war ein neues Heimatbewusstsein gefragt. Bei der Vermittlung waren Lehrer-Arbeitsgemeinschaften aktiv. Sie schrieben Heimatbücher, lokalhistorische Sammlungen kamen als Anschauungsunterricht dazu. Das erste "Bezirksheimatmuseum" entstand 1923 in Meidling. Sein Gründer, der Sonderschullehrer Karl Hilscher, erkannte grundsätzliche Voraussetzungen. Man brauchte einen Förderverein zur Finanzierung, die Unterstützung des Bezirksvorstehers und die Mitwirkung der Bevölkerung für den Aufbau der Sammlung. Zu weiteren Museumsgründungen kam es vorerst nicht, sie scheiterten allesamt an der Finanzierung oder dem mangelnden Raumangebot, schreibt Regina Wonisch von der Stabsstelle im Wien Museum.
1926 veröffentlichte die Magistratsdirektion einen Erlass über die Förderung der Bezirksmuseen durch die Gemeinde Wien. In die folgenden Jahre fielen die Gründungen in Landstraße, Favoriten, Simmering, Ottakring, Hernals, Währing und Floridsdorf. Der Zweite Weltkrieg führte zu Verlusten und Schäden an den Sammlungen. Danach sollte ein neues Österreichbewusstsein geschaffen werden. Wieder waren Pädagogen die Aktivisten und ihre Schüler die Zielgruppe. Einige Museumsleiter schlossen sich zur "ARGE der Wiener Heimatmuseen" zusammen. In diese Zeit fiel die Gründung der Museen in den Bezirken Leopoldstadt, Wieden, Josefstadt, Alsergrund, Döbling, Hietzing, Penzing, Brigittenau und Liesing. Außerdem wurden Privatsammlungen (Circus- und Clownmuseum, Ziegelmuseum, Phonomoseum, Rauchfangkehrermuseum, Museum Aspern-Essling 1809) als Sondermuseen in die ARGE aufgenommen. 1965-1974 sorgte die ARGE für kostenlose fachliche Weiterbildung. Aus Raritätenkabinetten sollten moderne museale Institutionen entstehen. Ende der 1960er Jahre gaben bereits neun Museen eigene Mitteilungsblätter heraus. In den 1970er Jahren entstanden die Bezirksmuseen Innere Stadt, Margareten, Neubau, Rudolfsheim-Fünfhaus und Donaustadt. Seither hat Wien als vielleicht einzige Weltstadt ein Museum für jeden historisch gewachsenen Stadtteil. … Die Wiener Bezirksmuseen sind exemplarisch in ihrer "Wildheit", sprich in ihrer außergewöhnlichen Anmutung. Aus der Überfülle an Objekten und deren Inszenierungen beziehen sie einen speziellen Charme. Die thematischen Arrangements von Geschäften und Werkstätten wirken liebevoll gestaltet und vermitteln nostalgisches Flair. Diesem speziellen Charme ist auch das Buch verpflichtet - wie schon der Titel ahnen lässt. Kreativ ist die Gliederung: Weder nach Bezirken, noch chronologisch, auch nicht nach Materialien, sondern persönlich und assoziativ, ganz wie es einer Wunderkammer entspricht.
Seit den 1970er Jahren zeichnen sich neue Museumsentwicklungen ab. Dem wissenschaftlichen Zeitgeist folgend, rückten Alltag und Arbeit in den Mittelpunkt des Interesses. Oral History, "Geschichte von unten", Demokratisierung, Citizen-Science-Projekte wurden verwirklicht. Die Pädagogen als Museumleiter wurden von Angehörigen anderer Berufe abgelöst - von Bankangestellten bis zu Ingenieurinnen. Nach der Jahrtausendwende zeigte die Stadt verstärktes Interesse an ihren Bezirksmuseen. 2020 richtete die Kulturstadträtin im Wien Museum eine "Stabsstelle Bezirksmuseen" mit fünf MitarbeiterInnen ein. Sie steht den Museen beratend zur Seite und unternimmt behutsame Schritte in Richtung Professionalisierung. Die Stabsstelle unterstützt bei Ausstellungen und mit Workshops, hilft bei Öffentlichkeitsarbeit und Web-Auftritt - wird allerdings von der etablierten ARGE als Entmachtung erlebt. Seit 2024 gibt es ein neues Wiener Museumsgesetz. Darin sind die Aufgaben des Wien Museums als Fachinstanz für die Bezirksmuseen ausformuliert und ebenso ist festgehalten, dass sich deren Sammlungen - von einzelnen Privatobjekten abgesehen - im Eigentum der Stadt Wien befinden. … Nur in der Verhandlung der zutage tretenden Konflikte kann ein lebendiger Austausch zur Stadtgeschichte gewährleistet werden. Die Bezirksmuseen sind der ideale Ort für diesen produktiven Prozess der Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft.
Den Bildteil, das Herzstück des Buches, hat Klaus Pichler mit Einfühlungsvermögen und künstlerischem Blick gestaltet. Manches mag hier interessanter erscheinen als in direkter Anschauung. Gleich am Beginn findet sich eine Sammlung von Feuerwehrhelmen aus Floridsdorf. Viel Prähistorisches (wenn auch nicht gerade das zitierte Auerochsenhorn) gibt es auf dem Foto aus Liesing zu sehen. Das (ländliche) Spinnrad steht im Bezirksmuseum Innere Stadt. Was es im Ensemble mit Kaiser Ferdinand und einem Heurigensessel zu tun hat, erschließt sich den LeserInnen nicht. Bei den Raumansichten wären erklärende Texte hilfreich gewesen, wie es bei den Einzeldarstellungen der Fall ist.
Bei diesen findet sich allerlei "Kurioses und Famoses", aber auch Wertvolles, zum Beispiel: Badebekleidung aus den 1920er Jahren ("Tragbares"), Pulver für Erbswurstsuppe ("Marken und Produkte"), die Tischklingel eines Hochradvereins ("Silbriges"), eine gläserne Schusterkugel ("Zerbrechliches"), eine Taschensonnenuhr mit Kompass ("Nützliches"), Sparefrohfiguren ("Kindheit"), altsteinzeitliche Knochenreste ("Bruchstückhaftes"), ein signierter Fußball ("Erinnerungsstücke"), ein Kruzifix aus dem Holz der Fregatte "Novara" ("K.u.k.-Nostalgie"), ein Entwurf der Kriegserklärung 1914 ("Dokumentarisches"), Modelle von Häusern und Verkehrsmitteln ("Maßstäbliches"), Hinweis-, Verbots-, Werbe- und Straßentafeln ("Beschildert"), Portraits und Veduten ("Gerahmtes"), ein Notenblatt um 1600 ("Papierenes"), ein Reliquienbehälter und ein Paradegeschirr für Wasserbüffel ("Goldiges"). Schließlich könnte das "Blaue Einhorn" die Verbindung zwischen Bezirksmuseen und Wien Museum symbolisieren: Während die Replik ein Highlight der Alsergrunder Sammlung bildet, ist das Original seit kurzem restauriert im Wien Museum zu bewundern.