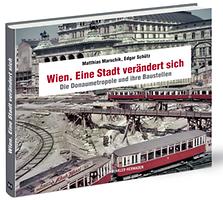Matthias Marschik - Edgar Schütz: Wien. Eine Stadt verändert sich #
Matthias Marschik - Edgar Schütz: Wien. Eine Stadt verändert sich. Die Donaumetropole und ihre Baustellen. Edition Winkler-Hermaden Schleinbach. 140 S. ill., € 28,90
"Sie habn a Haus baut, sie habn a Haus baut, sie ham uns a Haus herbaut", sang Arik Brauer in den 70er-Jahren. Kritisch und poetisch beschreibt der Künstler die Gefühle der überraschten Anrainer. "Gestern Nachmittag hab i beim Fenster aussegsehen, heute in der Früh haben s' mir den Himmel schon verstellt …" Baustellen machen nur den Beteiligten Freude. Der erste Bildteil ist Arbeitern, Bauherren, Architekten gewidmet. Auch Politiker sind hier zu sehen: Bei Einweihungen waren Politiker stets prominent vertreten. Bürgermeister Franz Jonas eröffnet die neu gestaltete Floridsdorfer Hauptstraße (1962). Im aktuellen Konzept von Stadt und Wirtschaftskammer "Wien baut vor" heißt es: Bei jährlich 1,2 Mrd. Investitionen sind das mehr als 20.000 Arbeitsplätze. Bauen ist damit ein Lebensnerv der Großstadt. Die idealistisch formulierte Sichtweise zitieren Matthias Marschik und Edgar Schütz in ihrem jüngsten Buch. Die beiden Erfolgsautoren der Edition Winkler-Hermaden haben hier zuletzt "Wien und seine Berge" veröffentlicht.
Ihr neues Buch dokumentiert Momentaufnahmen. Während Bildbände üblicherweise besondere Gebäude zeigen und unbedeutende Dorfansichten zu Ansichtskartenmotiven veredeln, geht es hier um Work in progress. Wie sieht es aus, wenn die Stadt gerade dabei ist, sich zu verändern ? Die Autoren beginnen ihre Geschichte der Baustellen in der Donaumetropole mit der Ersten Osmanischen Belagerung (1529). Danach wurden die Stadtbefestigungen neugestaltet und davor das unverbaute Glacis angelegt. Diese Freifläche verschwand ihrerseits nach dem von Kaiser Franz Joseph I. 1857 dekretierten Abriss der Stadtmauern und dem damit ermöglichten Bau der Ringstraße sowie der sie säumenden Prachtbauten. Die Ringstraßenära war die erste große Zeit der Fotografie. Ab 1860 erlaubte die Fototechnik kurze Verschlusszeiten und eine massenhafte Vervielfältigung der Bilder.
Rund 30 zeigen Infrastruktureinrichtungen der Gründerzeit, den Durchbruch zwischen Graben und Stephansplatz, den Kirchenbau im Weißgerberviertel, das entstehende Cottage zwischen Währing und Döbling, Gebäude wie den damals größten Kuppelbau der Welt, die Rotunde, Votivkirche, Parlament etc. Interessant, dass große Tafeln an der Fassade über die Projekte informierten, wie "Bau der k.k. Hofmuseen". Bauzäune dienten schon seinerzeit als Werbeflächen, für Holzöfen ebenso wie für ein Anatomisches Museum. Nachdem im Zweiten Weltkrieg etliche Ringstraßenbauten zerstört worden waren, erzählt das erste Kapitel auch über Nachfolger. Der Heinrichshof, "eine der nobelsten Adressen von Wien", ist bei seiner Dachgleiche zu sehen. 1945 beschädigte ein Bombenangriff das von Theophil Hansen geplante Wohn- und Geschäftshaus. Es hätte gerettet werden können, doch sprachen kommerzielle Interessen für einen Neubau. Der 1956 fertiggestellte Opernringhof gilt heute gemeinhin als Architektursünde, damals wurde er als modern und weltstädtisch empfunden. Als sensationell galten die Opernpassage und das so genannte Jonasreindl. Der Verkehrsknotenpunkt am Schottentor vereint die erste Tiefgarage Wiens und zahlreiche Straßenbahnlinien.
Die nächste Bauperiode Fin de siecle und Vorkriegszeit (deren Ende mit 1918 angegeben ist) zeigt 16 Bilder der städtebaulichen Entwicklung. Großprojekte waren damals z. B. die Wienflusseinwölbung (ab 1894), das Stadtbahnnetz (ab 1898), Sammelkanäle und Brückenbauten im Zusammenhang mit der Eingemeindung Transdanubiens (1904/05). Wien entwickelte sich zu einem kulturellen Zentrum mit dem Kaiser-Jubiläums-Stadttheater, dem Konzerthaus und der Urania. Nicht zu vergessen der 50.000 m² große Vergnügungspark "Venedig in Wien" und das 65 m hohe Riesenrad im Prater.
Das erste Jahrzehnt der Ersten Republik war im Roten Wien bautechnisch vor allem vom sozialen Wohnbau gekennzeichnet. Von 1923 bis 1934 entstanden 382 Gemeindebauten mit 65.000 Wohnungen. Beispiele dafür sind Gartenstadt, Fuchsenfeldhof und Karl-Marx-Hof. Die Bauarbeiter am Rabenhof (1925) stellen sich dem Fotografen, ebenso die Mörtelweiber vom Winarskyhof oder - auf privater Seite - die Arbeitenden der "Selbsthilfesiedlungen" wie am Rosenhügel (1922). Das Amalienbad, die "modernste und größte Badeanstalt Mitteleuropas" sollte den Proletariern Sport und Gesundheit ermöglichen. Das Bad wurde 1926 beim Arbeiterturnfest eröffnet. Eine ganz andere Ideologie verfolgte zwei Jahre später das Sängerbundesfest. Die dafür konstruierte Holzhalle bot Platz für 75.000 Personen.
Die Sozialdemokratie in Wien geriet ab 1927 politisch in die Defensive. Trotzdem entstanden Gemeindebauten. Der als "größter Wohnbau der Welt" geplante auf dem Friedrich-Engels-Platz wurde nur teilweise realisiert. In die Zeit der christlich-sozialen Stadtregierung fielen u. a. der Bau des Hochhauses in der Herrengasse, Praterstadion, Reichsbrücke und Höhenstraße. Gewaltige Umbaupläne für Wien wurden nach dem März 1938 entworfen. … Praktisch umgesetzt wurde vorerst wenig.
Im Zweiten Weltkrieg wurden mehr als 21.000 Wiener Häuser (21 %) beschädigt oder zerstört, 850.000 Tonnen Schutt lagen in den Straßen. In der folgenden Besatzungszeit waren sowjetische Soldaten "für Übergriffe und Willkür bekannt." Doch setzten die Pioniere die binnen Jahresfrist 13 Brücken instand. Als innovatives Projekt für den Wiederaufbau galt der 1953-55 errichtete 73 m hohe Ringturm. Die Autoren charakterisieren die Zeit von 1955 bis 1975 als "Wohlstandsgesellschaft" - mit dem Symbol der Stadthalle von Roland Rainer, deren Haupthalle 16.000 Besucher fasst. Als weitere "Signale in Richtung Moderne" stellen sie u. a. den Donauturn, das Vienna International Centre und die Donauinsel vor. Das U-Bahn-Netz führt zum Ausblick 2000-2020. Der Nachsatz zeigt einen Wald von dutzenden Kränen. Sie stehen in einem der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas in der Wiener Peripherie Bis in die 2030er Jahre sollen in der Seestadt Aspern mehr als 25.000 Menschen wohnen und 20.000 arbeiten.
Nicht in diesem Wien-Buch findet sich das Lied von Arik Brauer, aber Assoziationen drängen sich anlässlich des Baugeschehens der vergangenen Jahrzehnte auf: " Siehst den ganzen Tag a graue Mauer, kriegst a graues Herzel auf die Dauer. Spieln die Bubn auf ein' hartn Grund, kriegn ′s bald harte Augn, an harten Mund … Hat des Zimmer laute glatte Eckn, wo soll sich denn der Dackel da versteckn ? Hat die Kuchl ganz a grade Mauer wird die Butter hin, die Mülli sauer. Sie habn a Haus baut, sie habn a Haus baut. Sie ham uns a Haus herbaut."