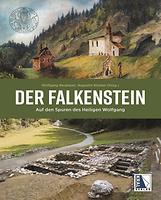Wolfgang Neubauer, Augustin Kloiber (Hg.): Der Falkenstein#
Wolfgang Neubauer, Augustin Kloiber (Hg.): Der Falkenstein. Auf den Spuren des Heiligen Wolfgang. Kral Verlag Berndorf. 284 S., ill., € 39,90
Der Falkenstein ist ein bewaldeter Felsriegel im östlichen Teil des Gemeindegebiets von Sankt Gilgen (Salzburg). Nach der Überlieferung soll sich der Heilige Wolfgang (924-994) dorthin zurückgezogen und einige Wunder gewirkt haben. Der gebürtige Schwabe war Benediktinermönch und Klosterreformator, Bischof von Regensburg, als Reichsgraf Politiker zur Zeit der Ottonen und Erzieher Kaiser Heinrich II. Der Heilige stammte aus gutem, wenn auch nicht adeligem Haus, war zwar hochgebildet, aber dennoch von niedrigem Stand und der Überlieferung nach voller Bescheidenheit. Seine Bestellung durch den Kaiser zum mächtigen Reichsbischof nahm Wolfgang nur aus Gehorsam an.
Die bewegte Biographie des Heiligen ist gut dokumentiert, trotzdem umranken Legenden seinen Lebenslauf. Zu den bekanntesten gehören die Einsiedelei auf dem Falkenstein am Mondsee und die Beilwurf-Legende. Demnach soll der Bischof vom Falkenstein aus eine Axt geworfen haben, um den Platz für den Bau einer Kirche zu erkennen. Er fand das Beil angeblich am Ufer des Wolfgangsees. im 13. Jahrhundert war der Beilwurf ein Rechtsbrauch bei der Grenzziehung, in diesem Fall in einem Streit zwischen dem - zum Stift Regensburg gehörenden - Kloster Mondsee und dem Erzbistum Salzburg. Das war allerdings lange nach Wolfgangs Zeiten. Die Legendensammlung wurde um 1400 aufgeschrieben. Historisch belegt sind diese Episoden jedoch nicht, schreibt der Herausgeber des Jubiläumsbandes, a.o. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Neubauer.
Der Experte für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie hat u.a. die Römerstadt Carnuntum, die Landschaft von Stonehenge und wikingerzeitliche Fundstellen in Skandinavien erforscht. 2023 erschien sein Buch "Älter als Stonehenge" über steinzeitliche Kreisgrabenanlagen in Niederösterreich.
Prof. Neubauer und sein Team haben 2009 begonnen, mit bodenphysikalischen Prospektionsverfahren den Geheimnissen der Klause auf den Grund zu gehen. Anlässlich des 1100. Jahrestags des Geburtstags des Heiligen Wolfgang im Jahr 2024 wurde das Ziel gesetzt, ein umfassendes Werk über alle bisherigen Forschungsarbeiten zu erstellen und diese gemeinsam mit den archäologischen Fundobjekten in einer musealen Präsentation der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In einem ersten Schritt wurde daher eine virtuelle Rekonstruktion der Klause auf Grundlage der bisherigen Forschungsergebnisse erstellt und mit dem modernen Gelände und den heute noch bestehenden historischen Bauten verbunden. Das vorliegende Buch ist die wissenschaftliche Dokumentation des Projekts und gibt Einblick in das Leben der Einsiedler zur Zeit der Gegenreformation.
Die international einzigartigen Projektergebnisse sollen die Basis für die - von der Gemeinde Sankt Gilgen gewünschte - Rekonstruktion des Gesamtensembles Falkenstein bilden. Den Fußweg von Sankt Gilgen über Fürberg auf den Falkenstein nach St. Wolfgang begingen seit dem 14. Jahrhundert Tausende Pilger. St. Wolfgang war eines der großen Wallfahrtsziele wie Rom, Santiago de Compostela, Aachen oder Einsiedeln. Die ersten Touristen der Region kauften Devotionalien, hofften Ablässe zu erlangen und spendeten Münzen. In manchen Jahren kamen 100.000 Pilger. Unter ihnen war anno 1506 Kaiser Maximilian I. von Habsburg. Er wollte sogar sein Mausoleum auf dem Falkenstein errichten lassen.
Die ab 2011 durchgeführten Untersuchungen der Universität Wien und des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie ermöglichen interessante Einblicke in die Wallfahrtsgeschichte. Sie widerlegten die vielfach vermutete prähistorische Besiedlung. Im Zuge der bisherigen Grabungen konnten jedoch keine derartigen Reste am Falkenstein entdeckt werden, die ältesten geborgenen Funde stammen aus dem Spätmittelalter. Eine Bilddokumentation zeigt und interpretiert sie im Detail. Highlight ist wohl die Taschensonnenuhr eines 1684 verstorbenen Fraters. Unerwartet und sensationell war die Entdeckung von zwei Kellern, der eine diente wohl als Vorratskammer. Der andere, durch eine Falltür verschlossen, führte zu einer hölzernen Wasserleitung, aus der wahrscheinlich das Wasser der als wundertätig geltenden Quelle von den Einsiedlern abgefüllt und verkauft wurde. Dazu gab es "Wolfgangiflascherl" aus blauem Glas. Ein zweites wichtiges Wallfahrtsandenken waren "Wolfgangihackel", die Frauen als Amulett um den Hals trugen. Diese Devotionalien wurden, ebenso wie Rosenkränze, offenbar von den Klausnern hergestellt und gegen Spenden ausgegeben.
Mit Bodenradarmessungen, Laserscanner und Luftbildarchäologie konnten die Fundamente der Klause zerstörungsfrei lokalisiert und danach ausgegraben werden. Dabei spielt die dreidimensionale digitale Dokumentation ein wichtige Rolle. Der Überblick zeigt vier Räume, mit Kachelofen und Herd in der Mitte, zwei Keller sowie eine Latrine außerhalb der Klause. Unerwartet war das massive Fundvorkommen, da man von einem spärlichen Besitzstand der Klausner ausgegangen war. Die Qualität der verschiedenartigen Keramiken zeugt von Gefäßen, die eher der Ausstattung eines gehobenen Haushalts entsprechen. Die Forscher nehmen an, dass Pilger die Brüder mit Nahrungsmitteln versorgten, die sie in diesen Gefäßen verpackten. Außer Keramik fand man Reste von Flaschen und Gläsern, Kleidungsbestandteile aus Metall, Besteck, Schmuck, Werkzeug, Münzen - meist aus dem 17. Jahrhundert. Zwischen 1659 und 1802 sind zwölf Einsiedler vom Falkenstein namentlich bekannt. Die Laienbrüder verfügten über persönlichen Besitz. Darunter Keramikpfeifen, die von Tabakkonsum zeugen, eine Maultrommel und eine Flöte, die zeigen, dass zumindest einige der Eremiten musikalisch waren oder Musik mochten. Ihre Kleidung wies Knöpfe und Gürtelschnallen auf. Tierknochen in der Latrine belegen den Fleischkonsum. … Die Einsiedler lebten nicht immer standesgemäß. Der Pfarrer berichtete, dass sie häufig bis in die späten Nachtstunden Tavernen besuchten.
Während die Klause verschwunden ist, blieb die Kirche am Falkenstein ein beliebtes Ziel. Das 1626 erbaute Gotteshaus ist zweischiffig und hat einen kleinen Dachreiter. Die Glocke gilt als Wunschglocke. Vom Kirchenschiff führt eine Steintreppe zur Höhle in der Falkensteinwand, die nach der Überlieferung die Zuflucht des Heiligen Wolfgang war. Die Pilger krochen durch eine Steinformation, um von Sünden erlöst oder von Krankheiten geheilt zu werden. Wichtig war ihnen auch die Quelle, die entsprungen sein soll, nachdem der Heilige mit einem Stab gegen den Felsen schlug.
Historisch belegt ist jedoch der Aufenthalt Wolfgangs im Stift Mondsee, anno 976, das der bayrischen Herzog Odilo im 8. Jahrhundert gegründet hatte. Zu Wolfgangs Zeit gehörte es zu den Besitzungen des Bistums Regensburg. Als bischöflicher Reichsgraf musste er dort nach dem Rechten sehen. Dazu zählten Rechtsgeschäfte, das Veranlassen von Rodungen und die Gründung von Kirchenbauten (in Oberwang und am Abersee). Trotz seiner hohen Stellung lebte er asketisch, doch Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Heilige Wolfgang tatsächlich als Einsiedler zurückgezogen hat, ist gering. Außerdem war er viel unterwegs. Auf einer Reise erkrankte er und bat, in der Kapelle - heute Kloster - von Pupping im Bezirk Eferding (Oberösterreich) zu sterben. Die herandrängenden Menschenmassen ließ er nicht vertreiben, sondern meinte Sterben ist keine Schande. Schande bringt nur ein schlechtes Leben. Sein Leichnam wurde nach Regensburg überführt. Der Heilige Wolfgang ruht in der nach ihm benannten, neu erbauten Krypta des dortigen Klosters St. Emmeram.