ANTIKE VERGANGENHEIT#
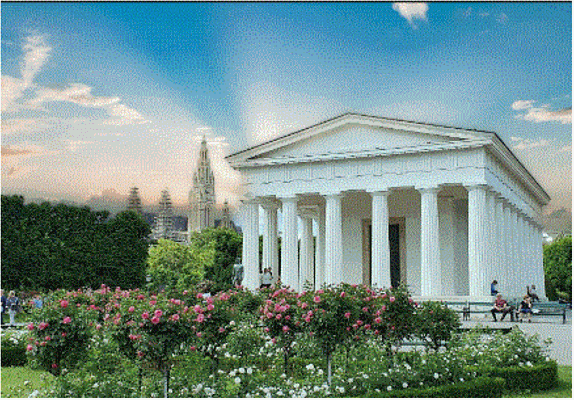
Aus der bunten Pracht von Blumen und Grün des Volksgartens, leuchtet im hellem Weiß der Theseustempel entgegen, ein Blickfang der durch Peter Nobile in den Jahren 1819 bis 1823 nach dem Vorbild des Theseions in Athen entstanden und als Aufstellungsort für den von Antonio Canovas geschaffenen Theseus Skulpturen-Gruppe, die jedoch ab 1890 in das Kunsthistorische Museum wechselte, und die Krönung des Haupttreppenhauses wurde.
Nachdem Canovas Skulpturen-Gruppe den Tempel verlassen, harrte seiner oft ein stiefmütterliches Dasein. Für ihn gab es weder Dauerausstellungen, noch Sammlungen, nur für periodische Ausstellungen stand er immer wieder im Mittelpunkt, so auch im Jahr 1934, als man ihn mit der Antikensammlung einen würdigen musealen Wert verlieh.
Wieder durfte er schützend einen Teil der Sammlung, die österreichische Gelehrte um die Jahrhundertwende aus Ephesos aus dem ewigen Dunkel rettend, nach Wien brachten, beherbergen.
Man konnte sich glücklich schätzen über die Zusammenfassung einer Provinzialkultur einer wohlhabenden Stadt Kleinasiens geschlossen dar zustellen und dafür im Kunsthistorischen Museum Raum für eine Neuaufstellung, die die Sensation der Herbstausstellung werden sollte.
Das waren noch außergewöhnliche und reichhaltige Zeiten als das archäologische Institut der Wiener Universität Expeditionen nach Kleinasien unternehmen konnte und Abdul Hamid II., der von 1876 bis 1909 Sultan des Osmanischen Reiches die kostbaren Funde dem Kaiser Franz Joseph schenkte. So knapp bei Kassa dieser 34. Sultan auch war, mit Antiquitäten Geschenke zeigte er sich mehr als großzügig. Er wollte Österreich auf Josef Strzygowskys Intervention die herrliche Fassade des Palastes von Mschatta, die mit Reliefs bedeckte Fassade der jordanischen Wüstenresidenz, zum Geschenk machen. Leider missfiel dieses Weltwunder den damaligen Herrschaften und so ist es heute der Stolz des Kaiser Friedrich Museum in Berlin.
Im klassischen Ephesos dessen Dianatempel der heute so aktuelle Herostratus verbrannte, arbeiteten damals englische Archäologen. Die Österreicher gruben im Gebiet der Neustadt, die, im dritten vorchristlichen Jahrhundert von Lysimachos König von Thrakien, an der Küste begründet, in der römischen Kaiserzeit die prunkende Hauptstadt der reichen Provinz Asia war. Die tragischen Masken, die einst das Theater von Ephesos schmückten, hängen in der Cella des Theseustempels, und darunter steht ein greifengetragener Marmorstuhl aus der Hofloge. Gewaltige Frauengestalten schmückten die Front der Bibliothek und auf dem Forum ragten prunkvoll gepanzerte Statuen der Imperatoren, denen längst göttliche Ehren zuteil wurden. Die Büste eines Priesters ist zu sehen, der im orientalischen Kopfschmuck das kleine Bildnis des Kaisers trägt, dessen Kult er vorstand. Aber noch gab es an allen Straßenecken die schönen Hermen des bärtigen Dionysos, Symbole des alten, frohen Naturmythos, und über den Altären lag ein Abglanz griechischer Schönheit.
Die weltliche Kunst war längst andere Wege gegangen. Ein realistisch dräunender Löwe und das Knäblein mit der Gans. Die Porträtplastik wünschte wirklichkeitsnahe Römer vor allem realistische Bildnistreue und gerade diese Köpfe waren es, die das überraschende Erlebnis der Neuaufstellung sind. Mit dem Porträt eines bärtigen Griechen und dem strengen Bildnis Julius Cäsars beginnt eine Reihe, die bis zu Darstellungen des fünften Jahrhunderts reicht, mit denen das Mittelalter anhebt, die uns überliefern, wie die Leute aussahen, die auf dem Konzil von Ephesos 431 die Verehrung Marias als Gottesmutter beschlossen. Die Bildwerke stehen auf wundervoll gezeichneten Marmorsäulen, die einst die Tempel Ephesos zierten. Schon das Raumbild der Neuaufstellung ist ein ästhetischer Genuss.
Man kann eine volle Stunde im Theseustempel verbringen, aber damit ist der Reichtum nicht erschöpft, den die Österreicher aus Ephesos mitbrachten. Eine zweite, bedeutsame Reihe von Bildwerken musste im unteren Belvedere untergebracht werden. Es handelt sich um Teile eines Ehrenmales, das an den Sieg erinnern sollte, den Marc Aurel und sein Mitkaiser Lucius Verus, der die militärischen Aufgaben inne hatte, 165 nach Christi Geburt über die Parther, ein iranisches Volk, dessen mächtiges Reich nicht nur aus dem heutigen Iran, sondern noch aus den umliegenden Gebieten bestand, beherrscht wurde es von der Asakiden-Dynastie, davontrugen. Früher lagerten diese Reliefplatten im letzten Saal des Barockmuseums und sind heute im alten Galastall des Belvederes viel vorteilhafter aufgestellt. Neben bewegten Kampfszenen und Allegorien, die unverfälschtes antikes Barock sind, gibt es eine lebensgroße Statue Marc Aurels, der mit Lucius Verus und dem Kronprinzen Commodus zum Siegesopfer schreitet.
Wahrscheinlich wissen nicht viele Wiener, dass bei uns ein zeitgenössisches Denkmal des Imperators zu sehen ist, der in Vindobona starb.
Im Berlin Bodes hätte man um solche Schätze wohl ein Glashaus gebaut, wie um den Pergamonaltar. Wir stellen sie in einen Pferdestall, der allerdings des Prinzen Eugen Prunkstall ist.
Die Tageszeitungen informierten ihre Leser sehr ausführlich über die Ephesos-Ausstellung im Theseustempel: „Die Ausstellung enthält die bei den österreichischen Ausgrabungen in Ephesos 1895 bis 1906 auf dem Gebiet der hellenistisch-römischen Stadt gefundenen Bildwerke vom 5. vorchristlichen Jahrhundert bis in die Spätantike, darunter bisher der Öffentlichkeit noch nicht gezeigte Statuen. Eintritt 20 Groschen“.
QUELLEN: Die Stunde, 14. Juni 1934, Neues Wiener Tagblatt, 31. Mai 1934, Österreichische Nationalbibliothek, ANNO
Wissenssammlungen/Essays/Historisches_von_Graupp