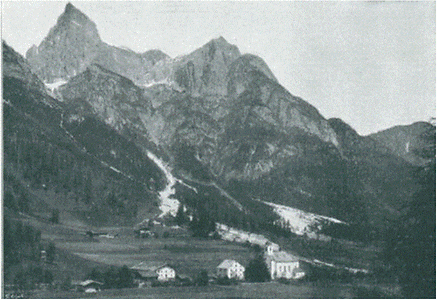DAS GSCHNITZTAL#
Eines der lieblichsten Seitentäler des Wipptales, ist das Gschnitztal, das sich in den Stubaier Alpen befindet, wurde am 30. Juni 2025 nach einer Hitzeperiode von einem furchtbaren Unwetter heimgesucht, dass die Bewohner in Furcht und Schrecken versetzte. Sintflutartig rauschte unter Blitz und Donner mit Hagel durchsetzt mit einer Intensität über das Alpental nieder. Schlamm und Geröll und ungeheure Gesteinsmassen wälzten sich drohend durch das Tal und hinterließen Verwüstungen mit katastrophalen Ausmaßen.
Der Bereich um die Pfarrkirche Maria Schnee war besonders arg betroffen, bis nach Mühlberg gingen immer wieder massive Muren ab. Am nächsten Tag kam es hier noch schlimmer.....
Im August 1921 hatte das Gschnitztal durch ein Unwetter besonders schwere Verheerungen angerichtet. Mit Hagel vermischte heftige Regengüsse lösten an den schroffen Felshängen der Ilm- und Kirchdachspitze mehrere Murbrüche aus, die einen großen Teil der Wiesen und Felder überflutete und die erntereifen Kulturen vernichteten. Der Schaden wird auf mehr als eine halbe Million geschätzt.
Nicht anders erging es dem Gschnitztal im August 1922 ein Unwetter großen Schaden anrichtete. Nicht nur die Felder wurden unter Wasser gesetzt, die Brücke weggerissen und durch den hochführenden Schmiedbach wurden sieben kleine Bergmühlen zerstört.
Endlich gab es am 18. Juni 1925 etwas Erfreuliches zu berichten mit der Nachricht, dass ein neuer Weg zur Innsbrucker Hütte führt. Damit ist der Anstieg aus dem Gschnitztal über die steilen, gefährlichen plattigen Hänge, die unter den Touristen sehr verrufen waren, vorbei. Von der Brücke aus, aufwärts in den sogenannten „Tobel“ auf markierten Weg zur Alfer Alpe führt, kann anschließend die alte Route wieder benützt werden. Damit ist ein lang gehegter Wunsch der Sektion Innsbruck in Erfüllung gegangen.
1929 besaß eine Anzahl von Österreicher bereits ein Auto, nämlich 9.354, dazu kamen die Autobesitzer aus dem Ausland. Jeder wollte sein gewähltes Reiseziel mit dem Auto erreichen. So auch das idyllische Gschnitztal. Doch zur großen Überraschung der Ankommenden gab es für sie ein Autoverbot auf der Straße ins Gschnitztal. Sie zeigten sich empört. Waren doch durch die vielen Maut- und Verbotskuriositäten die bereits in Österreich herrschten das Land bei den Autofahrern sehr berüchtigt. Wehe jemand versuchte es trotzdem von Steinach nach Trins oder Gschnitz zu fahren, der erlitt einen Verlust von 50 Schilling die er als Strafe hinterlegte, musste er das Tal wieder verlassen.
Das Verbot hatte unter dem Fremden schon zur großen Unzufriedenheit geführt, für sie war es unverständlich, dass ein Fremdenverkehrsort derartige Maßnahmen traf. Was nutzten die schönsten Hotels und Pensionen, wenn man diesen die modernste und einzige praktische Art des Zubringerdienstes unmöglich macht? Gegen diese rückständigen Verbote müsste mit Entschiedenheit vorgegangen werden, denn jede unerquickliche Szene schadete dem Fremdenverkehr.
Der Stegerhof in Gschnitz brannte am 16. April 1932 ab, war jedoch im Juni wieder im Bau. Die ersten Gäste, waren zur Freude der Dorfbewohner, bereits im romantischen Gschnitztal eingetroffen.
In diesem Jahr wurde auch Anton Kerner von Marilaun gedacht, der ein großer Freund der Natur gewesen, als Professor an der Universität Innsbruck und Direktor des Botanischen Gartens wirkte. Seine Liebe zur Alpenwelt war so groß, dass er sich im Gschnitztal in der Nähe des Tribulaun und Habicht auf einen Moränenhügel ein Landhaus erbauen ließ um die jährlichen Ferien zu verbringen.
Den Irrtum von 1929, kein Auto in das Gschnitztal zu lassen, hatte man bald bereut. Im Sommer 1932 verfügte das Gschnitztal über reichliche Verbindungen jeden Besucher und Gast zu empfangen, ob er nun per Postbus aus Innsbruck anreiste, die Firma Menardi brachte Feriengäste mit dem Wagen. Die Post hatte mit ihrem „Reklame-Apparat“ endlich Propaganda für das Gschnitztal unternommen. Verärgert darüber, dass auf dem Bozner Platz in Innsbruck, hingegen nur Werbung für das Stubaital statt fand. Zu den beiden Autokonzessionen gesellte sich heuer noch die Steinacher, die dreimal täglich nach Gschnitz Gäste brachten. Außerdem erwartete man durch das Verkehrsbüro Steinach weitere Fremde die vom Gchnitztal begeistert waren.
Einen Höhepunkt erlebte das Gschnitztal im Jahr 1937 als ein Ehrengast aus dem fernen Wien eine Rundreise durch das Wipptal unternahm. Bundespräsident Miklas wurde in Trins und Gschnitz auf das Freundlichste aufgenommen. Besichtigte die Kirche, ließ die prächtige Alpenwelt auf sich wirken und setzte die Fahrt nach Steinach fort.
Eine fünf Meter hohe Lawine brach am 27. März 1946 von der Hohen Perlspitze in Trins los, sie ging durch die Zwieselmähder ins Tal und kam auf der Straße Trins-Gschnitz zum Stillstand.
Im Herbst 1947 waren in Tirol bis zu 14 Waldbrände zu bekämpfen, einzelne von ihnen haben katastrophale Ausmaße angenommen. Dazu gesellte sich noch der Föhn der das Feuer von der bayerischen Seite mit einer ungeahnten Schnelligkeit auf das österreichische Gebiet trieb. Die bayerische Feuerwehr konnte weder ihre Schlauchleitungen retten, die verbrannten, noch die Motorpumpe mit Benzin gefüllt, explodierte.
Das österreichische Waldgebiet zwischen der Scharte und dem Schleifersteig glich bald einem wogenden Flammenmeer. Die Löschmannschaft war ständigem Steinschlag ausgesetzt, dass sich durch die große Hitze zu lösen begann.
Das Gschnitztal blieb von dieser Feuerhölle nicht verschont und bildete nach kurzer Zeit eine zweieinhalb kilometerlange Ausdehnung der Flammen, die sich an den Steinschlagwänden hoch fraßen. Die Steine durch das Feuer heiß geworden, verursachten immer wieder neue Brände. Die Mannschaft der Feuerwehr reichte gegen dieses Inferno nicht aus, durch Radioalarm wurde um Verstärkung gebeten. Die Alarmierten trafen aus Schwaz und Telfs bald darauf ein. Nun standen elf Kraftspritzen mit einer Motorleistung von 320 PS die an verschiedenen Positionen Aufstellung nahmen, um dem Feuer Herr zu werden. Zu den neun Feuerwehren hatten sich auch freiwillige Helfer des Tales bereit gefunden.
Glaubte man das Feuer in den nächsten Stunden unter Kontrolle zu bringen, inzwischen war Südwind aufgekommen der die Flammen nun erst recht auflodern ließ...
Für einen Naturfreund und Wanderer hat das Gschnitztal viel zu bieten. Nicht nur ist man von den prächtig geformten Zinnen der Ilmspitze beeindruckt, des Kirchdaches bestaunt und dem Pflerscher Tribulaun bewundert, dazu die Pflanzenwelt, lila Brunellen, Kuckucksblumen, Speiks und all den anderen bunten Kostbarkeiten die hier zu finden sind. Ein Paradies nicht nur für den Menschen auch für die Tierwelt.
Um das wunderbare Gebiet in seiner Schönheit zu erhalten, war durch eine Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, jener Teil von Trins taleinwärts 1949 zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Mit dieser Maßnahme wollte man die herrliche Natur, die Vielfalt ihrer Geschöpfe in ihrer Ursprünglichkeit für kommende Generationen beibehalten.
Im Juni 1949 bekam das einsam gelegene Bergkirchlein von St. Magdalena im Gschnitztal von einer Gruppe von Männern und einer Frau Besuch. Das romantische Gotteshaus mit seiner Einsiedelei wies schwere Schäden auf. Unter der Gruppe befand sich Provikar Dr. Wechner, Dr. Oswald Graf von Trapp als Landeskonservator von Tirol, der Pfarrer von Trins A. Mayr. Univ.-Prof. Dr. Th. Rittler, Frau Dr. Gritsch, Obermedizinalrat Dr. Steiner von Matrei.
Man widmete sich sehr eingehend auf bauliche Schäden und Arbeit. Großes Interesse galt den verborgenen Fresken die als kleine Probe frei gelegt, zu sehen waren und aus dem 15. Jahrhundert stammen dürften. Zur großen Überraschung wurde festgestellt, dass unter diesen Fresken eine noch ältere Malerei zu erkennen war.
Eine eingehende Untersuchung und Freilegung der Fresken die zu den ältesten Nordtirols gezählt werden dürfen, wird vom Landesdenkmalamt nach Fertigstellung der Bauarbeiten in Angriff genommen.
Man kam zu dem Entschluss, dass das Kirchlein auf alle Fälle gerettet werden müsse.
Sehr arg musste das Unwetter 1951 in Gschnitz gewesen sein. Der haselnussgroße starke Hagelschlag verursachte wieder schwere Verwüstungen. Minutenlanges unheimliches Rollen und Rauschen von der Thorsäule und der Ilmenspitze schreckte die Bewohner auf, bis in der breiten Schotterhalde außerhalb der Kirche die Güsse nieder rauschte, mit Gestein und Wasser die angrenzenden Wiesen mannshoch verschüttete. Wasser drang in Häuser und Stallungen ein und die Straße in Richtung Trins war meterhoch verlegt. Der Hagel war so dicht, dass die Hänge der Ilmen- und Zeisspitze wie bei Neuschnee weiß aufleuchteten.
Nach dem Bau riesiger amerikanischer Kasernenanlagen bei Wals und Siezenheim in Salzburg, schließt sich die französische Besatzungsmacht damit an ebenfalls mit dem Bau von Kasernen zu beginnen.
So soll in Gschnitztal ein zweites „Siezenheim“ geschaffen werden. Ohne die Bauern zu informieren, beschlagnahmte die französische Besatzungsmacht Überfalls artig Gründe der Bauern die dazu benötigt wurden. Dann fuhren Autokolonnen auf die Felder, nahmen keine Rücksicht auf das geerntete Korn und vernichtete es.
Die Bauern hielten eine Protestversammlung ab, die bis in die späten Nachtstunden dauerten. In einer Resolution wurde beschlossen, dass der Trinser Bürgermeister bei der Landesregierung und beim Gemeindeverband gegen den Bodenraub und Kriegsvorbereitungen zu protestieren. Die Arbeiterschaft hatte sich ihnen angeschlossen.
Das gestohlene Gebiet umfasste 21 Hektar das mit Stacheldraht vor der Zivilbevölkerung geschützt wurde. 40 Baracken errichtet, die für 5000 Mann Unterkunft boten. Angrenzend an die Baracken, entlang der Waldgrenze, in die Berge entstanden Munitionsstollen. Wie Bauern eruierten, standen 400 Waggon mit Zement bereit für die Festungsbauten. Die Bevölkerung des Tales war über die Militäranlagen mehr als ungehalten. Sie wollten nicht durch die unmöglichen Kriegspläne der imperialistischen Aggressoren hineingezogen werden. Ein Abgesandter des Innenministeriums kam, sah, und musste wieder unverrichteter Dinge nach Wien zurückkehren.
Westösterreich soll zu einer waffenstarrenden „Alpenfestung“ umgestaltet werden. Kürzlich war General Eisenhower im österreichisch-italienischen Gebiet zu Besuch.
Bekanntlich unterstützte die Bundesregierung 1952 die USA Kriegspläne in Westösterreich. In der französischen Zone Österreichs haben die Amerikaner die Kriegsvorbereitungen mit allen Mitteln in Angriff genommen. Amerikanische Truppen wie auch Inspektionen bewegen sich in Tirol und Vorarlberg wie in der eigenen Zone, sie errichten Militärbauten wie in Rum bei Innsbruck, verlangen strategische Straßenbauten, kurz sie kommandieren, während die Franzosen zu gehorchen haben. Die Bodenbeschlagnahmen im Gschnitztal wurden wohl von der französischen Besatzungsmacht durchgeführt, jedoch es besteht kein Zweifel, auf wessen Anordnung.
Neuerdings so wird berichtet, sind riesige Munitionstransporte, die von Stainach am Brenner in das Gschnitztal geführt werden, wo sich bekanntlich ein großes Truppen- und Waffenlager der französischen Besatzungsmacht befindet. Enorme Mengen von Munition sind hier bereits aufgestapelt. Während dieser Transporte darf kein anderes Fahrzeug hier unterwegs sein. Zur Überwachung werden Funkwagen eingesetzt.
Mehrere Jahre sind vergangen, seit das St. Magdalenakirchlein besucht wurde. Der „Verein für Heimatschutz in Tirol“ hat sich mit einem Lichtbildervortrag um das Sorgenkind im Gschnitztal angenommen. Von seiner Höhe aus hat man eine herrliche Aussicht auf die Kirchdachspitze, Thaursäule und Ilmspitzen, schweift der Blick zum in der Sonne glitzernden Schneefeld des Habicht, der als Bannberg der Hexen und bösen Geister galt.
In der Ferne leuchten die Schneefelder vom Simming und den Feuersteinen. Das Kirchlein wird von Zeusspitz und vom Thorspitz drohend überragt. Seltsam, dass man in grauer Vorzeit auf derlei Höhe ein Kirchlein errichtete. Nicht nur das Volk liebte das Heiligtum sondern auch Kaiser und Könige bedachten es mit Stiftungen. Kaiser Maximilian hat um 1500 eine alte Stiftung erneuert und noch zwei Pfund Berner aus der Zollstätte am Lueg gegeben. Kaiser Maximilian war im Gschnitztal mehrmals in Bergnot.
Nach den Urkunden die man in Trins gefunden hatte, wurde St. Magdalena 1449. Eine Ablassurkunde vom 13. April 1407 für „Marie Magdelein in Monte“ blieb erhalten. Eine Geschichte vom 2. Oktober 1307 hat nämlich „Anna, von Gottes Gnaden Königin zu Behaim und zu Bolan, Hertzogin zu Karenden und Gräfin zu Tyrol“, die Frau des Landesfürsten König Heinrich von Böhmen, hatte dem St. Magdalena Kirchlein jährlich zehn Pfund Berner aus den Einkünften der landesfürstlichen Saline in Hall vermacht. Daher feierte St. Magdalena 1957 den 650. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung.
Das alte berühmte Kirchlein barg noch ein anderes Geheimnis, hinter dem Altar, wo ein aus dem Felsen gehauenes Becken immer mit Wasser gefüllt ist. Sonderbar war die Lage des Kirchleins, das gegen Süden und nicht gegen Osten schaut. Der Baugrund musste dem Felsen erst abgerungen werden, seltsam auch die geheimnisvolle Gründungssage, die von Tieren handelt und keinerlei Zusammenhang mit der Magdalenaverehrung stehen die Wallfahrten der Bauern aus Ellbögen 14 Stunden hin und zurück. Es scheint als sei Magdalena eine der größten Wallfahrten Tirols gewesen, die auch von Kaiserin Maria Theresia und Joseph II., verehrt wurden und aus dieser glanzvollen Zeiten künden die wertvollen Fresken. Außerdem hatte es ein großes Vermögen erworben und schenkte seinen Anteil zur Gründung der Kuratie von Trins 1666 und 100 Jahre später war sie auch die Gründerin der Kirche in Gschnitz. Unter Joseph II., der eine Kirchenreform durchführte und eine Vereinfachung des Gottesdienstes wünschte, verfügte Magdalena über ein Vermögen von 700 Gulden. 1804 war die stattliche Summe von 40.000 Gulden wieder erreicht.
QUELLEN: Innsbrucker Nachrichten, 3. August 1921, 18. Juni 1925, 31. August 1929, 16. September 1947, 6. Mai 1932, Erlafthal Bote, 6. August 1922, Tiroler Bauernzeitung, 4. April 1946, Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 7. Juni 1932, 28. Juni 1937, Österreichische Zeitung, 18. Juni 1952, 22. Jänner 1952, 4. September 1951, Tiroler Nachrichten, 16. Juli 1951, 1. August 1949, 6. Mai 1954, Wienerwald Bote, 6. Februar 1932, Österreichische Nationalbibliothek, ANNO.
Wissenssammlungen/Essays/Historisches_von_Graupp