DER GROSSGLOCKNER#
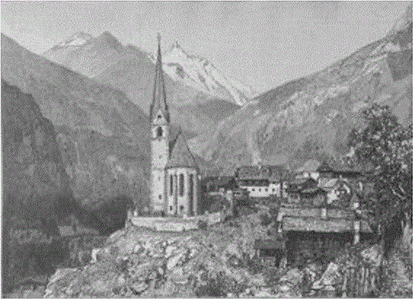
Der Ortler mit seinen 3.905 m, ein Gigant der alle Berge überragt, war der höchste Berg der Monarchie Österreich-Ungarn. Nachdem das zweitgrößte Reich Europas zerfallen war, wählte man den Großglockner, mit nur 2.504 m als den höchsten Berg Österreichs.
1844: Der erste der diese Wildnis betrat und die Aufmerksamkeit auf den Großglockner lenkte, war der Gelehrte Alt Wulfen, der in diesem Gebiet zwanzig neue Pflanzen entdeckte. Bereits in frühester Zeit wurde hier Bergbau betrieben. Nach einer Volkssage sollen hier unter Eis und Schnee Schätze verborgen sein.
Ein hoher Naturfreund kam 1799 hierher zu Besuch, Fürstbischof von Gurk Salm-Reifferscheid-Krautheim. Ihm war es zu danken, dass der Großglockner für Bergsteiger interessant wurde. So ließ er eine Berghütte auf der Salmshöhe errichten und eine weitere auf der Hohenwarte Ruheplätze um die Schönheiten der Natur zu genießen. In Gesellschaft mehrerer Gelehrten unternahm er selbst 1800 eine Reise zum Glockner. Dauner befanden sich Schiegg, der die Messung besorgte, sowie Professor Hoppe und zum Andenken wurde am höchsten Grat des Glockners ein Kreuz errichtet. 1809 wurde die Salmshütte von den Tirolern zerstört und die Hohenwarte von Eis und Schnee verschlungen, fast jedes Jahr ereilte ihr dieses Schicksal Wie das Glocknerbuch Auskunft gibt, wurde der Glockner meist von Naturgelehrten der näheren Umgebung aufgesucht. Bekannte Namen waren darin zu entnehmen wie 1795 Freiherr von Zoys, Dr. Hoppe aus Regensburg, Dr, Martins aus Erlangen, Dr. Hornschuh aus Greifswalde, Dr. Barthing aus Hannover, Dr. Braun aus Salzburg... nur wenigen ist der Aufstieg des Glockners gelungen, auch die wissenschaftliche Ausbeute ließ zu wünschen übrig, trotz allem füllt ein in vier Bänden Schultes Glocknerreisen, auch in Zeitschriften wurden in Aufsätzen Werbung für den Glockner gemacht.
Der Glockner war nicht so schwierig zu erobern, wie so mancher Schweizer Berg. Die Naturkundler kamen hierher um eventuell Geheimnisse zu enthüllen. Das Glocknergebiet bot weniger Gefahren und man konnte mit Muße die Natur in diesen Regionen bewundern. Hoppe besuchte bereits seit 30 Jahren jeden Sommer die Glockner Region
1856: .Eine Freudenbotschaft durchwehte die Bevölkerung Kärntens. Sie wurden durch die Information überrascht, dass das Kaiserpaar Heiligenblut aber auch den Großglockner besuchen und bis zur Pasterze vordringen wollte. Erzherzog Johann, ein großer Wanderer, war auch schon im Glocknergebiet und eine Hütte trägt seinen Namen. Rittmeister Graf Coloman Hunyady Adjutant Kaiser Franz Joseph, erstieg den Glockner bis zur Hohenwartshöhe und die Neugier trieb ihn natürlich auch zum Pasterzengletscher.
1868: Die Herren Buchhändler und Postoffizial Wazulik aus Graz hatten gerade eine erfolgreiche Besteigung des Großglockners hinter sich.
Am 6. September waren sie aufgebrochen und nach 24 Stunden Bahn- und Post in Lienz eingetroffen. Bereits Mittags verließen sie Lienz und langten nach 5 Stunden in Kals ein. Über das Ködnitztal und Berg waren sie 5 Stunden später auf der Wanitscharte bei der Stüdelhütte. Schon morgens um halb 3 Uhr bei Mondschein und Sternen übersäten Himmel erreichten sie nach 5 Stunden über das Ködnitz Kress, Adlersruhe hoch über die erste Spitze und um 8 Uhr morgens auf die Hochspitze des Großglockners. Auf der Hochspitze wurde einige Zeit Rast gemacht, Es herrschte Stille, Temperatur war sehr angenehm und ein wolkenloser Himmel über sich. Mittags fanden sie sich wieder bei der Adlersruhe ein. Über die Salmshöhe, Hohenwartscharte, das Leiter Kress und das Leitertal mit der Katzenstiege kamen sie am Abend in Heiligenblut an, und fanden in Groders Gasthaus „Zum Glockenwirt“ freundliche Aufnahme...
Je bekannter der Großglockner, desto mehr wurden Pläne für eine Reise für den Sommer geschmiedet. Die Zahl der Bergsteiger und die Touristenströme nach Heiligenblut nahmen zu. Im Glocknerbuch haben sich die Bergsteiger mit ihren Touren und Erlebnissen verewigt. Durch die Eisenbahn war nun jedes Ziel rascher und bequemer zu erreichen.
1914: Seit Jahrzehnten gehörte ein großer Teil des Felsmassivs am Großglockner einer Familie von Aichenegg, Mit all dem Felsgestein und dem Schmelzwasser des Gletschers wusste man eigentlich nichts abzufangen, da auch der Bestand der Gämsen sehr gering war. Würde nicht auf der Kärntner Seite ein kleines Gut zu diesem ausgedehnten Besitz gehören, so hätte der Grundbuchsbogen und das Parzellenverzeichnis über den Großglockner für die Besitzer kaum einen reellen Wert.
Eines Tages meldete sich ein Herr Willers aus Bochum Norddeutschland, der durch einen Güterspekulanten, mit 60.000 Kronen in den Besitz des Großglockners kam. Willers, wohl ein Weidmann, doch kaum erfahren in den alpinen und touristischen Verhältnissen Österreichs, richtete ein geschäftsmäßiges Schreiben an den Alpenverein, worin er bekannt gab, dass er die meisten Wege zum Gipfel des Großglockners zu schließen beabsichtige, und mit den Touristenvereinen darüber zu beraten, Wege offen bleiben sollten. Die Gründe waren die Jagd waren die Ursache. So einfach war dieses Vorhaben allerdings nicht, denn der Großglockner war eine Hochburg der Bergwanderer und wurde von zahlreichen Unterkunftshäusern gesäumt und seine stattlichen Nebenspitzen, der hohe Berg mit der grandiosen Fernsicht hat Anhänger, Tausende und Abertausende, und für sie ist der Großglockner ein Nationalheiligtum der allen frei zugänglich war. Nun sahen sie sich ihrer Freiheit beraubt. Das wollten sie sich nicht bieten lassen. In Sitzungen und Beratungen wurde darüber diskutiert. Die Tagesblätter hatten nun wieder ein Thema, es regnete Proteste und Interpellationen in den Landtagen, die Landesverbände für Fremdenverkehr erhoben ihre Stimme gegen Willers. Die Bergführer fürchteten um ihre Existenz. Ein Kampf um den Liebling aller Naturfreunde hob an. Der Reichsratsabgeordneter Dr. Steinwender brachte einen heftigen Leitartikel im „Neuen Wiener Tagblatt“ indem er die Großglocknergeschichte zum Anlass nahm, die Wegverbote überhaupt als Auswüchse des Jagdsportes zu bekämpfen. „Die Naturfreunde“ in Wien rief eine große Volksversammlung ein in der Reichsratsabgeordneter Dr. Ellenbogen über den „Unfug“ der Wegverbote mit Vehemenz loszog.
Also Reichratsabgeordnete, Volksversammlungen, Interpellationen, alle gegen die Jagd. Das Ende eine wütende Jagdhetze. Nnn kam es darauf an, ob die Aicheneggs es gestatten, dass jedermann über den Großglockner kletterte, so ist das ihre Sache. Es wäre direkt ein Verhängnis für die Forst- und Jagdbesitzer, wenn der Großglockner diese Frage in negativem Sinn ins Rollen brächte. Ein regelrechter Kampf mit der Touristik könnte der Jagd nur schaden. Daher Vorsicht ist geboten! Man wundert sich, wenn das öffentliche Interesse so groß ist, warum war der Berg den Touristen nicht jene 60.000 Kronen wert?
Es ist verständlich, wenn aus Sicherheitsgründen bei Jagden Wege gesperrt werden. Jene die überhaupt für ein Jagdverbot tendieren, sind jene Leute, die ihren Jagdhass hinter der Maske der „Naturfreundlichkeit“ bergen.
Man möge das Herz und den Mut haben, die Jagd zu schützen......
1949: Der Großglockner führte bis in das Jahr 1799, ein einsames Dasein. Nun wurde er plötzlich von einem Menschen erobert. Jahrhunderte früher war er sogar noch namenlos. Man vermutete in seinen Höhen Dämonen die sich durch Steinschlag und Lawinen bemerkbar machten, sobald sich ein Fremder sich näherte.
Allmählich begannen sich Naturwissenschaft und Geographen für ihn zu interessieren. Da sein Name unbekannt war, wurden die Einwohner der Gegend befragt. Von den Bauern erfuhr man, dass sie ihn nur unter Glogger kannten, woher der Name kam, blieb ein Geheimnis. Möglich dass es eine Ableitung von Klocken war, ein Ausdruck, der der Bergmannsprache entnommen war. Wurde doch hier Goldbergbau betrieben.
Als Entdecker des Glocknergebietes kommt der Österreicher Balthasar Hacquet der im 18. Jahrhundert ins Mölltal kam um die Höhe des Berges zu bestimmen, Seine Schätzung 3900, nicht so schlecht. Bereits 200 Jahre vorher war Wolfgang Lacius, dem Hofhistoriographen Ferdinand I., veröffentlichen Atlas der österreichischen Alpenländer vom Jahr 1561 als einziger Gipfelname neben zahlreichen Tauernpässen der „Glocknerer“ eingetragen. 1583 nennt eine Grenzbeschreibung des Amtes Kals in Osttirol den „Glogger“ und in der berühmten „Topographia Provinciarum Austriacarum“ von Merian, die im, die im Jahr 1649 erschienen ist, wird den Berg als „Glöckner Mtns“ verzeichnet. Auf der bekannten, 1774 von den Tiroler Bauernkartographen Peter Anich und Blasius Huber gezeichneten Karte erscheint der Glockner zum Zeichen seiner außerordentlichen Höhe mit einem Stern geschmückt.
Ein interessanter Mann erscheint 1791 im Mölltal, dessen Name immer ehrenvoll genannt werden wird, Domdechant Sigismund von Hohenwart. Der Großglockner beeindruckt ihn so sehr, dass er diesen besteigen wollte. Diesen Unternehmenswunsch erfüllt er sich einige Jahre später, mit großem Erfolg. 1799 soll die Besteigung in Angriff genommen werden. Große Unterstützung findet Hohenwart in Fürstbischof von Gurk, Altgrafen von Salm-Reifferscheid. Die Ersteigung wurde gewissenhaft und mit wissenschaftlicher Gründlichkeit vorbereitet. An der Südwestseite des Glocknerkammes eine wohnliche Hütte aus Holz errichtet. Die Brüder Klotz unternahmen eine Forschungsfahrt und mussten wegen Schneesturm umkehren.
Einen weiteren Versuch unternahmen sie am 23. Juli, der jedoch misslingt. Erst das Unternehmen am 25. August bestanden sie siegreich. Den Gipfel eroberten außer 4 Einheimische, nur der Generalvikar Hohenwart und ein weiterer Begleiter. Der Kleinglockner wurde aus diesem Anlass mit einem Kreuz ausgezeichnet. Hütten wurden errichtet. Am 28. Juli 1800 waren es bereits 62 Personen mit 16 Pferden die sich zur Salmhütte aufmachten, darunter der Fürstbischof, Generalvikar Hohenwart und sämtliche Naturforscher. Am nächsten Tag erreichen 4 Führer mit dem Pfarrer von Döllach den Gipfel. Der Bann war gebrochen. Seither erfreut sich der Großglockner größter Beliebtheit bei all den Bergfreunden.
QUELLEN: Neue Tiroler Stimmen, 28. Mai 1868, Österreichische Forst Zeitung, 17. Juli 1914, Bozner Zeitung, 23. September 1868, Neue Salzburger Zeitung, 23. August 1856, Der Adler, 26. Februar 1844, Tiroler Nachrichten, 29. August 1949, Salzburger Volksblatt, 1. August 1890, Österreichische Nationalbibliothek, ANNO
Wissenssammlungen/Essays/Historisches_von_Graupp