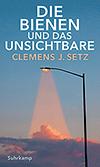Unentdeckte Kontinente warten #
Ein Plädoyer für die Beschäftigung mit Plansprachen: Clemens Setz bietet in seiner neuen Veröffentlichung „Die Bienen und das Unsichtbare“ einen Streifzug durch künstlich gewachsene Sprach- und Literaturwelten. #
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von: Die Furche (20. Oktober 2020)
Von
Maria Renhardt

Foto: Amrei-Marie. Aus: Wikicommons
In Kanada unterrichtet eine junge Lehrerin in den frühen Siebzigerjahren Kinder mit Zerebralparese. Sie können, obwohl sie wach sind, nur ganz rudimentär kommunizieren. Einmal setzt die Lehrerin Symbole ein, um herauszufinden, welchen Zugang die Kinder zur Welt haben. Aber alles ändert sich, als sie eines Tages das Buch „Semantography“ von Charles Bliss entdeckt. Hier dringt sie in ein dynamisches Symbolreich ein, das für die Kinder ein Tor zur Außenwelt wird. Denn mit den Symbolen, auf die man zeigen kann, können die Kinder plötzlich kommunizieren und ihre Bedürfnisse und Wahrnehmungen mitteilen.
Der Grazer Schriftsteller Clemens Setz beschäftigt sich in seiner neuen Veröffentlichung „Die Bienen und das Unsichtbare“ in sechs Kapiteln mit der Welt der Plansprachen, mit ihrer Geschichte, aber besonders auch mit ihren poetischen Möglichkeiten. Der Buchtitel zitiert einen Satz Rainer Maria Rilkes: „Wir sind die Bienen des Unsichtbaren.“ In dieser Äußerung sieht Setz „die beste Definition“ für Kunstsprachen: „Sie bringen Ertrag und Nährstoffe von einer Quelle, die sonst kaum jemand sehen kann. Wer eine erst vor Kurzem erfundene Sprache spricht, macht sich in gewisser Weise vor der Weltgeschichte unsichtbar .... Nur in einer neuen, völlig geschichtslosen Sprache können dich die alten Götter nicht erkennen. Du bist frei, umtriebig. Du bist gefährlich.“
Aus Karl Blitz wird Charles Bliss #
Mag sein, dass Setz diesen Band, an dem er schon vor sechs Jahren zu arbeiten begonnen hat, zunächst als Sachbuch konzipiert hat, schlussendlich hat er aber zu einer ungewöhnlichen Hybridform gefunden. Durch diesen Text mäandern zahlreiche persönliche Spuren als locker gestricktes und zwanglos entfaltetes Crossover von Tagebuchaufzeichnungen, Lektüreerfahrungen, Erinnerungen oder Begegnungen mit Menschen, die in der Kunstsprache für eine kleine Community schreiben.
Setz hat intensiv recherchiert und dieses sprachliche Paralleluniversum mittels Studien, Artikeln aus Fachjournalen oder zahlreichen literarischen Beispielen gründlich und innovativ erforscht. Bevor Karl Blitz sein eigenes Symbolsystem entworfen hat, ist er davon überzeugt, dass Sprache, solange sie „eine klangliche Oberfläche“ besitze, „anfällig und korrumpierbar“ sei. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wird er deportiert, er kommt mit Hilfe seiner Freundin frei und kann nach England fliehen. Dort löst sein Nachname Angst aus, „weil ‚Blitz‘ auf Englisch ‚Bombardierung‘ bedeutet“. Als sich das Kriegsgeschehen ausweitet, flieht er nach Shanghai, das damals noch Juden aufnimmt. Dort lernt er sofort Chinesisch. Die neuen Schriftzeichen inspirieren ihn zur Kreation „einer allein aus Symbolen bestehenden Sprache“, die frei von idiomatischen Ausdrücken, von „Vieldeutigkeit und Unschärfe“ sein sollte, um nicht instrumentalisiert werden zu können. Sie wird später Blissymbolics genannt. Und dennoch kann man in dieser Sprache auch dichten. Setz bringt als Beispiel Texte von Mustafa aus Somaliland, der heute in Malmö lebt. Blissymbolics ermöglicht ihm die Kommunikation trotz schwerer Zerebralparese. Dessen Gedichte „Rollstuhlmann“ und „Spastiker“ hat Setz übersetzt. Die bloßen Symbole fokussieren die Bedeutung: pure meaning, pure poetry. „Du siehst, was die Welt wirklich ist.“
Von der reinen Symbolsprache rauscht Setz zur sprachlichen Inspiration, die sich aus Google-Translate-Nonsens-Übersetzungen ziehen lässt, und zu einer weiteren Plansprache: Volapük, einer heute fast bedeutungslosen Sprache. Sie sollte als „internationales Verständigungsmittel“ friedensstiftend wirken. Während seiner „mysteriösen Autoimmunerkrankung“ versucht Setz, sich diese Kunstsprache selbst anzueignen. An Volapük fasziniert ihn die „Kompaktheit mancher Phrasen“. Er übersetzt zahlreiche Gedichte des Volapükisten Johann Schmidt und beginnt in dieser Zeit, unter anderem „nach dem Vorbild des Volapük“ eine eigene Sprache zu bauen. In der Beschäftigung damit wird ihm eine „Verbindung zwischen spontaner Wörter- und Spracherfindung und tiefer existenzieller Krise“ bewusst.
Esperanto-Freundschaften #
Über die Nonsens-Sprache, wie sie etwa der Künstler August Walla auf zahlreichen Gegenständen, Steinen oder Bänken in Gugging hinterlassen hat, spinnt Setz den Faden schließlich zu Esperanto. Im Zentrum dieses Kapitels stehen die abenteuerlichen Erfahrungen des erblindeten russischen Anarchisten und Autors Eroschenko. Der Verlust des „aktiven Blicks“ hat sein Leben elementar erschüttert. Dass er auf den Rat einer Lehrerin hin Esperanto gelernt hat, rettet ihn. Diese Sprache fungiert für ihn als Katalysator und schenkt ihm aufgrund der Esperanto-Freundschaften auf der ganzen Welt wieder Selbstständigkeit. Native Speaker berichten von einem heute noch aktiven Esperanto-Netz. Denn „Esperanto“ ist „ein vor Möglichkeiten berstendes System“. Die zahlreichen Dichtungen in dieser Sprache, die Setz auch in seiner eigenen Übersetzung vorstellt, zeigen zudem einen blühenden poetischen Kosmos.
Dieser dichte und anregende Streifzug durch das Universum der Plansprachen liest sich überdies als experimentelle Reise durch unbekanntes literarisches Terrain in künstlich gewachsenen Wortlandschaften. Ganz nebenbei generiert er ein Nachdenken über den Zusammenhang von Sprache, Denken, Wirklichkeit – zwischen Frames und bloßer Wortbedeutung. Setz ist ein Sprachenfreak. Er plädiert für einen schärfenden Blick über den Tellerrand, weil „hinter der Straßenbiegung ... unbekannte Kontinente warten“. Wenn man einreist, muss man sich wappnen. Schließlich könnte man ja auf Kafkas „Katzenlämmer“ treffen.
Die Bienen und das Unsichtbare
Von Clemens J. Setz
Suhrkamp 2020
416 S., geb.,
€ 24,70