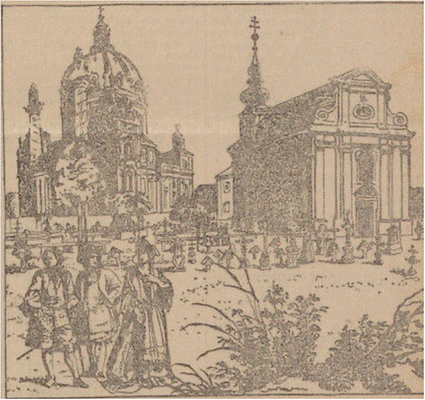DER KARLSPLATZ#
Bilder sind Dokumentationen über Ansichten einer Stadt oder eines Platzes, die alle Veränderungen wiedergeben die es im Laufe der Epochen gegeben hatte. Altes fiel der Spitzhacke zum Opfer um Neues, Prächtigeres erstehen zu lassen. Vertraut blieb nur die Silhouette der Karlskirche, die 1716 bis 1739 durch J. B. Fischer von Erlach entstanden ist. Kaiser Karl VI., erteilte den Bauauftrag und gelobte sobald die Pest besiegt ist, eine Kirche bauen zu lassen. Die Karlskirche, Karl Borromäus ist der Schutzheilige der Kranken.
Nach einem zeitgenössischen Kupferstich ist eine Kapelle gleich in der Nähe der Karlskirche zu sehen. Wo sich heute die Technik, und der Resselpark befinden, war einst der Armesünder-Gottesacker, in dessen Mitte die Kapelle des heiligen Augustin, ein überaus stattlicher Bau, sieh befand. Friedhof und Kapelle sind unter Kaiser Joseph II., verschwunden, vor allem aus hygienischen Gründen.
Der aufgelassene Friedhof reichte bis in das 13. Jahrhundert zurück und gehörte zum heiligen Geist-Bürgerspital, einem berühmten Haus. 1208 gegründet und im 15. Jahrhundert eingegangen – Pleite. Derartige Etablissements leistete man sich als Privater die von dem Vermögen leben mussten die ihnen zur Verfügung standen.
1897 beschäftigte sich der Wiener Gemeinderat mit dem Areal des Karlsplatzes, der verbaut werden sollte. Die Baulinien für die Baublöcke östlich der Karlskirche wurden festgesetzt. Beim Baublock nächst der Lothringerstraße ist ein Stadtmuseum vorgesehen, daher ist das geplant gewesene Stadtmuseum auf dem Schmelzgründen gegenstandslos geworden.
Das Stadtbauamt findet es an der Zeit die Verbauung des Karlsplatzes endlich in Angriff zu nehmen. Um die Wirkung des Stadtmuseum auf dem Karlsplatz zu erproben wurde eine Schablone aufgestellt, dabei wurden beachtenswerte Einwendungen erhoben, welche ihre Ursachen nicht nur in der Stellungnahme gegen das von Oberbaurat Otto Wagner entworfene pompöse Museumsprojekt hatten, denn der herrliche Blick auf die Karlskirche würde sich negativ auswirken. Andere erhoben wieder den Wunsch den Karlsplatz von sämtlichen Bauvorhaben frei zu halten, stattdessen wurde eine Gartenanlage favorisiert. Das Stadtbauamt teilte diese Ansicht nicht, da die Abgrenzung des Platzes Gebiets mäßig einen künstlerischen Abschluss erfordert, da die dort befindlichen Häuser den Ansprüchen der Neuzeit nicht mehr entsprachen. Es gibt nur eine Lösung in der Errichtung palaisartiger Bauten die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen. Oberbaurat Professor Ohmann hatte bereits im Jahr 1902 ein Regulierungsprojekt veröffentlicht, dessen Grundsätzen gleichfalls teilt.
Stadtbaudirektor Goldemund hat nach eingehenden Studien mit großem Geschick und künstlerischem Verständnis, die Baulinien der beiden Baublöcke derart abgeändert, dass der Blick auf die Karlskirche von der Lothringerstraße aus, zirka 30 Meter vom Schwarzenbergplatz, gegeben ist. Außerdem würde damit erreicht, dass die von Ohmann und anderen bedeutenden Künstlern, die für nötig gehaltene symmetrische Begrenzung der Karlskirche an der abgeflachten Ecke der Hochschule leicht erfolgen kann.
Es wurde erwartet, dass sich die Künstler Wiens der städtebaulichen Angelegenheit großes Interesse entgegen bringen und in der Öffentlichkeit damit eine heftige Diskussion auslösen.
Der Stadtrat wollte zahlreiche Künstler zur Begutachtung des Objektes gewinnen, die Zentralkommission, den Architektenklub des Künstlerhauses, den Ingenieur- und Architektenverein, die Technische Hochschule, die Akademie der bildenden Künste und die Gesellschaft österreichischer Architekten, je einen Delegierten zu entsenden, um die Meinungen dieser Fachgruppen zu erfahren.
Der Bau des Stadtmuseums in dieser Region hatte im Gemeinderat ungewöhnliche Debatten ausgelöst, die Forderung wurde erhoben, dass nur solche Gebäude, die die Vornehmheit des Bezirkes noch erhöhen, gebaut werden dürfen. So beschloss man einen Wettbewerb unter den hervorragenden Architekten der Stadt ausgeschrieben wird, um künstlerisch einwandfreie Fassaden zu erhalten, ein Verbot an Geschäftsläden an gewissen Fronten. Mit der Ausgestaltung des Karlsplatzes gab man sich damals derart viel Mühe, wie jämmerlich präsentiert er sich heute.
Ein Palais in einem ungewöhnlichen Baustil säumt den Karlsplatz. Die französische Botschaft, auffallend die Eigenart des Stils, dass sie schon von weitem als fremdländisches Bauwerk kennzeichnet. Die französische Regierung war bestrebt damit die heimatliche Kunst auch im Ausland vorzustellen.
Sie befindet sich zwischen zwei der schönsten Plätze der Residenzstadt, dem Schwarzenbergplatz und dem Karlsplatz.
Die Vorbereitungen zum Bau eines Botschaftspalais in Wien, reichen bis 1901 zurück. Im Herbst 1904 wurde mit den Erdarbeiten begonnen. Die Pläne wie auch die oberste Bauleitung befanden sich in Paris. Der Architekt, der mit dieser interessanten Aufgabe betraut wurde, der schon als junger Mann mit dem Rom Preis, einem Stipendium für Studien nach Italien ausgezeichnet wurde, Paul Chedanne.
Gerade der ungewohnte Baustil, so meinen Fachleute, werden kaum Beifall finden. Für uns ungewohnt. Man wusste nicht soll der Stil mit Barock oder gar Empirestil in Verbindung gebracht werden? Es gibt auffallende Abweichungen von der Wiener Bauweise. Die Küche befindet sich unter dem Dach. Geschirr- und Speisentransport erfolgt durch Aufzüge. Die Repräsentationsräumen im ersten Stock zeichnen sich durch elegante hohe Fenster aus. Es sind nicht nur Salons, sowie Fest- und Speisesaal untergebracht. Kreisrundes Verbindungsvestibül mit Galerie und einer Feststiege und nebenan der Lift. Vor allem die Hauptfassade, ein Gesamtbild von Schönheit und Fremdartigkeit. Hervorragend die Eckrisalite und die mit Bronzereliefs geschmückten Giebeln, darstellend „Austria“ und France“ von Paul Gasq und Francois Sicard. Sie verleihen dem Gebäude die besondere Note. Übrigens ist Wien die einzige diplomatische Vertretung der Welt die im Stil des „Art Nouveau“ sich präsentiert.
Die Bauausführung erledigte die Wiener Union-Baugesellschaft. Für die feinere Innenausstattung zog man heimische Firmen heran. Die Baukosten betrugen 2 ½ Millionen Francs.
QUELLEN: Wiener Bauindustrie Zeitung, 1915, Jahrgang 32, 1909, Jahrgang 27,Ill. Wiener Extrablatt, 28. August 1927, Österreichische Nationalbibliothek, ANNO
Wissenssammlungen/Essays/Historisches_von_Graupp