PRIVATBAUTEN#
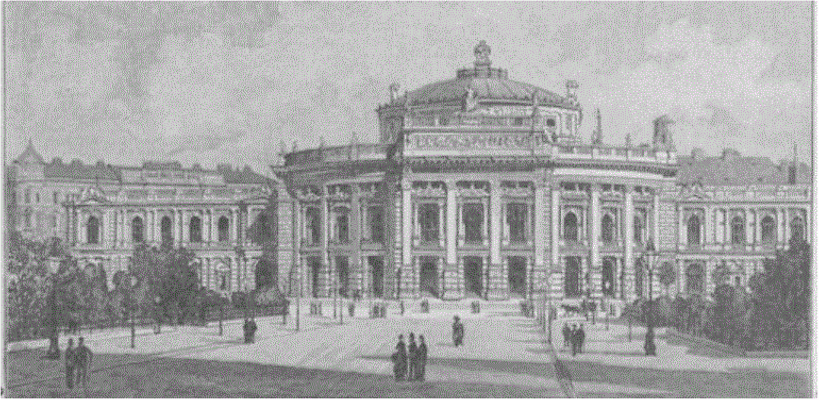
Das kaiserliche Wien besaß 1857, 8793 bewohnbare Häuser, darunter 300 die dem Staat dienten, so befanden sich pro Haus 55 Bewohner, in 89.441 Wohnungen.
Der Industrielle Eduard Drasche, Fabrikant und Immobilienmakler, einer der Wohlhabendsten der Residenz, kaufte die ersten Gründe, musste sich allerdings verpflichten, die erworbenen Baugründe binnen 5 Jahren vollständig zu verbauen und damit nur anerkannte Architekten zu beauftragen, die es verstanden prächtige Bauten aufzuführen und der Donaumetropole zu Ansehen und Schönheit zu verhelfen.
Nun setzte eine gewaltige Bautätigkeit ein, denn so mancher angesehene Bürger folgte dem Beispiel Drasche. Davon profitierten zwei Baugesellschaften, die „Österr. Baubank“ und die „Wiener Baugesellschaft“. Diese beiden Gesellschaften erwarben den Großteil der noch verfügbaren Bauplätze am Schotten- und Burgring um billige Wohnhäuser zu errichten. Die Privatkäufer beeilten sich ebenfalls auf den Stadterweiterungsgründen rasch zuzugreifen, da sie gleichfalls billige Wohnhäuser herstellen wollten. Eine nie gekannte Bautätigkeit setzte ein und Wien nahm an Größe zu. Doch die Klagen an Mangel kleinerer Wohnungen verhallten dennoch nicht und so versuchte der Bürgermeister Dr. Felder, 1870 durch ein Konsortium von Kapitalisten zu erreichen, dass Zinshäuser mit billigen Kleinwohnungen herzustellen. Sein Versuch misslang.
Ein Jahr nach der Wiener Weltausstellung waren die Baugründe rund um die im Bau befindlichen Votivkirche „Zum göttlichen Heiland“, an der Seite der Alserstraße, mit Wohnhäuser verbaut. Hier hatten sich Angehörige des Adels, die Geldaristokratie und wohlhabende Bürger Grundstücke auf den Stadterweiterungsgründen erworben und damit die Häuserspekulanten mit ihren geplanten Billigwohnungen verdrängt. Damit war ein neuer Stadtteil entstanden, mit dementsprechenden palastähnlichen Gebäuden die der Stadt ein neues vornehmes Gepräge verliehen.
Unter den Bauherren befinden sich bedeutende Persönlichkeiten: der Bankier Moriz von Königswarter, Herrenhausmitglied und jüdischer Philanthrop, Gustav Ritter von Eppstein, ein österreichischer Industrieller und Bankier, dessen Palais an der Wiener Ringstraße in jüngster Zeit Parlamentszwecken dient. Adolf Pollak von Rudin ein österr. Seifen- und Zündwarenfabrikant, der Bankier Ignaz Ephrusi, Anton Dreher, österr. Bierkönig, der in Schwechat das erste untergäriges Lagerbier der Welt braute, Michael Dumba, Direktor der österr. Nationalbank und griechischer Konsul, Freiherr von Rothschild, Verwaltungsrat und Gesellschafter, Fürst Colloredo Mannsfeld, ein österr. Staatsmann und so könnten noch zahlreiche Persönlichkeiten genannt werden.
Aus dieser Reihe der Genannten ist zu ersehen, dass es ihnen nicht schwer gefallen sein konnte, die nötigen Summen für die Bauten aufzubringen und waren überzeugt, dass sie diese Ausgaben in wenigen Jahren durch Mieten wieder zurückerhalten werden.
Auf dem Kärntner- und Opernring befanden sich imposante Gebäude, darunter muss der Heinrichshof erwähnt werden, der in seiner Besonderheit, noch dazu der Hofoper gegenüber, durch reiche Ausstattung aufgefallen war.
In den Jahren 1863 und 1864 wurden die ersten Häuser entlang der Ringstraße auf dem Kolowratring, benannt nach dem böhmischen Staatsmann und Gegenspieler Metternichs, Graf Franz Anton von Kolowrat-Liebsteinsky und der Parkring. Allmählich waren die Bauplätze auf der Ringstraße fast vergeben und ein prächtiger Bau nach dem anderen reihte sich an den anderen. 1873 gab es nur mehr einzelne Gründe die noch zu erwerben waren.
Der Schottenring war als Schlusslicht hinsichtlich der Verbauung zu betrachten. Trotz allem sind auch in diesem Teil der Ringstraße interessante Bauten vorzufinden. Theophil Hansen ist mit der Börse und dem Palais Hansen damals Großhotel vertreten. Das Ringtheater in dem sich das Feuerinferno 1881 abspielte, Hotel de France, sowie der riesige Komplex der Creditanstalt Bankverein.
Ab 1864 war die Wohnungsnot besiegt, Großwohnungen mit mehreren Zimmern standen wieder leer.
Neu Wien war entstanden - die Ringstraßenzeit, der Prachtboulevard, die Hochblüte von Kunst und Kultur, wurde zur Welthauptstadt der Musik, denn nur hier konnte sich der musikalische Zauber all der Großen der Komponisten entfalten, Architektur mit ihrer Vielfalt und Ästhetik, eine Sehenswürdigkeit, für all jene die Wien besuchen. Nicht vergessen darf die Mal- und Bildhauerkunst, die Millionenwerte aufweisen, Wien, darf sich glücklich schätzen, besitzt sie doch Kostbarkeiten aus allen Epochen, die Aufnahme im Weltkulturerbe fanden.
QUELLE: Wiener Geschichtsblätter, 1958 Nr. 1, Österreichische Nationalbibliothek, ANNO
Wissenssammlungen/Essays/Historisches_von_Graupp