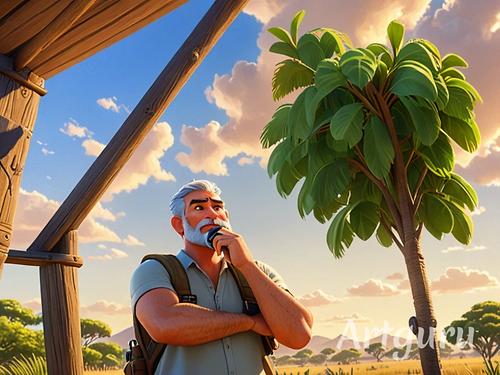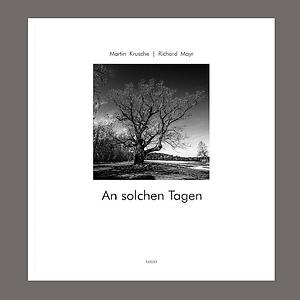Die Grammatik des Rauschens: Technologiesprünge#
(Die Kunst am Scheideweg: Künstliche Intelligenz als Herausforderung und Chance)#
von Martin KruscheDer Mann hat in seinem Metier einen weiten Bogen technischer Innovationsschritte mitgemacht. Es begann für Fotograf Richard Mayr im Grunde mit historischen Glasnegativen aus dem Besitz seiner Familie.
Das bedeutet, er hatte schon als Kind jenen Medienbereich näher kennengelernt, der seinerzeit keineswegs generell zu den heimischen Haushalten gehörte. Im Gegenteil. Fotografie war im 19. Jahrhundert bezüglich Ausrüstung und Sachkompetenzen ein überaus anspruchsvolles Genre. Das änderte sich prinzipiell erst im Jahr 1900 mit der Kodak Brownie und dem praktischen Rollfilm.
Über verschiedene Formate führte Mayrs Weg schließlich zur Digitalfotografie. Dabei ersetze der Computer mit Bildbearbeitungssoftware die Dunkelkammer mit ihren roten Lampen, den Chemikalien und der physischen Manipulation von Licht („Abwacheln“ etc.).
Neue Werkzeuge#
Folglich war Mayrs fotografische Arbeit schon beizeiten mit der Unterstützung durch digitale Werkzeuge zu erledigen. Heute ist die sogenannte „Künstliche Intelligenz“ darin (vorerst) essenziell nichts anderes: ein Werkzeug- und Assistenzsystem. Aber man kann durchaus von einer nächste Automatisierungswelle radikaler Art sprechen.Doch auch hier gilt, wie schon in den industriellen Revolutionen davor: Was die EDV den Menschen an Arbeitsdetails abnimmt, vergrößert den Entscheidungsraum für das, was Menschen können, aber Maschinen nicht. Also Klärungsbedarf, denn das ordnet sich nicht von selbst.
Da wir uns im Archipel gerade in Sachen Wissens- und Kulturarbeit betrifft näher mit dieser Technologie befassen, war Mayr neugierig, was ihm eine ChatGPT-Version zur folgenden Themenstellung liefern würde: „Die Kunst am Scheideweg: Künstliche Intelligenz als Herausforderung und Chance“.
Da heißt es dann zum Einstieg, Zitat: „Die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in die Kunstwelt markiert einen tiefgreifenden Wandel, der kreative Prozesse, den Kunstmarkt und den philosophischen Kunstbegriff selbst infrage stellt. Die Debatte oszilliert zwischen Euphorie über neue Ausdrucksformen und Existenzängsten traditioneller Künstler:innen. Dieser Artikel analysiert die multifacetede Rolle der KI in der Kunst anhand zentraler Konfliktfelder.“ (Den Link zum Volltext der KI finden Sie am Seitenende!)
Dieser Text macht anschaulich, welches semantische und welches sachliche Problem sich da für mich auftut. Etwa in folgender Passage: „Studien zeigen, dass 64% des Publikums KI-Kunst positiv aufnehmen.“ Da ich solche Software – wie erwähnt - für ein Werkzeugsystem halte, gibt es für mich keine „KI-Kunst“. Ich halte das für Begriffs-Unfug aus irgendeiner Marketing-Abteilung. Wir sprechen ebenso wenig von Kamerakunst, Schreibmaschinenkunst oder gar Pinselkunst.
Kamerakunst?#
Der Fotoapparat macht keine Bilder. Er ist bloß ein Apparat, nach physikalischen Prinzipen gebaut. Der Fotograf macht die Fotos. Und genau so sehe ich das bezüglich KI, solange man mir keine Evidenz nachweist, daß die Maschine ein Bewußtsein entwickelt hat, um Entscheidungen zu fällen, wie wir Menschen das in künstlerischen Prozessen tun.Mayr ist der Künstler, nicht einer seiner Fotoapparate. Die Kamera ist Hardware, die Software ist ein Algorithmus. Darin wirkt kein Geist, keine eigenständige Intelligenz. Was diese Dinge an Routinen implementiert haben, an Regelwerken und Hebelwerken, ist Maschinenwelt. Dingwelt. Das ist nicht belebt.
Haben wir nicht Dada hinter uns? Andy Warhol? Ready Mades? Fluxus etc.? Und das ist alles voriges Jahrhundert. Haben wir im Kunstdiskurs nicht Nelson Goodman und Boris Groys als Anregungen erlebt? Valorisierung und Trivialisierung. Dynamische Zuschreibungen. Wurde nicht schon längst deutlich, daß die Frage „Was ist Kunst?“ von der Frage „Wann ist Kunst“ abgelöst wurde?
Im KI-Text heißt es etwa: „KI könne somit ästhetische Resonanz erzeugen.“ Das will ich gerne glauben. Eine bedeutende Schnittstelle der verschiedenen Genres. Aber weshalb sollten wir das, was die Maschine bietet, nun Kunst nennen? Ich halte sowas für Dekoration, weil die KI nichts Bestimmtes will, sondern Parameter computiert. Ich mache als Künstler, in meinem Fall: Lyriker, etwas ganz anderes. Ich habe Intentionen. Die Maschine nicht.
Eine Frage der Begriffe#
Na klar, wir sagen – schlampig genug – „Künstliche Intelligenz“, obwohl diese Maschinenintelligenz nichts vom Wesen menschlicher Intelligenz hat. Na, dann ist es auch völlig egal, wenn ich von Menschen geschaffene Kunstwerke kategorial nicht von „Maschinenkunst“ unterscheide?Nein, es ist nicht egal. Und das ist keine „moralische“ Frage und letztlich auch keine des Marktwertes. Es ist vor allem eine Frage, ob man Semantik ernst nimmt und welche Auffassung von der Conditio humana vorherrscht. Wenn wir keine geklärten Begriffe haben, wissen wir nicht, wovon wir reden.
Ich sage, etwas polemisch verkürzt: Gäbe es plötzlich keine Menschen mehr, wäre da keinerlei Notwendigkeit für die Natur, ihre vielfach ästhetisch sensationellen Schöpfungen begrifflich von dem zu unterscheiden, was wir als menschliche Kunstwerke deuten.
Wir kennen diese Kategorie Kunst bloß, weil wir Menschen über symbolisches Denken verfügen, das - ganz unabhängig von Alltagserledigungen und zweckrationalen Aufgaben - aktiv ist. Um seiner selbst willen, um der Menschen willen. Tiere brauchen keine Kategorie Kunst. Ein Gebirge braucht sie nicht, kein Fluß, auch kein Wald. Maschinen brauchen sie ebenso wenig.
Aber so, wie manche Menschen ihre Hündchen als „Quasi-Menschen“ behandeln, belieben das offenbar auch manche Leute mit Maschinen zu tun. „Sie ist ja so lieb. Und sie versteht jedes Wort, das ich sage.“ Na klar! Das glaub ich sofort!
- Startseite: Die Grammatik des Rauschens (Eine Befassung mit Maschinenintelligenz und verwandten Themen)
- Der zitierte Text: Die Kunst am Scheideweg (Was die KI erzählt)
Weiterführend#
Lyriker Martin Krusche und Fotograf Richard Mayr sind die Autoren des Buches „An solchen Tagen“ (Edition Keiper, Graz), zu dem es eine webgestütze Extension gibt:- An solchen Tagen: Das erweiterte Buch (Eine Schnittstelle zwischen Realraum und Cyberspace)
- Das Kulturforum: Archipel Gleisdorf (Wissens- und Kulturarbeit)
- Das Projekt-Booklet: In Sachen Kunst (Archipel & Kunst Ost)