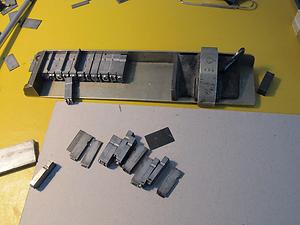Die Reisen des Herren Tocqueville#
(Ein Beitrag zum Projekt Mensch und Maschine)#
von Martin KruscheDer Historiker und Publizist Alexis de Tocqueville, dem die Politikwissenschaft einiges verdankt, bereiste im 19. Jahrhundert Amerika, um im Auftrag der Regierung Frankreichs das dortige Rechtssystem und den Strafvollzug zu studieren. Folglich publizierte er in zwei Teilen sein bekanntestes Werk: „Über die Demokratie in Amerika“. (Der erste Band erschien 1835.)

Tocqueville habe, wie viele Europäer, die Handwerksprodukte Amerikas in ihrer Qualität für minderwertig gehalten, und zwar ganz einfach deshalb, weil sie in höheren Stückzahlen billiger produziert wurden. Dies stünde im Kontrast zu den akzeptierten Qualitätsstandards in Europa. Das schreibt Carroll Gantz in seinem Buch „The Industrialization of Design“ (A History from the Steam Age to Today, 2011).
Mit den akzeptierten Qualitätsstandards in Europa meinte er ein Verschönern der Produkte, ein Veredeln durch Handwerksleistungen, die mit der eigentlich praktischen Funktion der Produkte nichts zu tun hätten. Das habe die Kosten der Güter angehoben.
Gantz ist selbst Industriedesigner und war Ende der 1980er Präsident der Industrial Designers Society of America (IDSA). Er zieht aus der eben zitierten Betrachtung folgenden Schluß: „Das Konzept eines sozialen Wertes aus dem Produktangebot für einfach Leute, statt bloß für die Upper Class, für Kunden, die Nützlichkeit dem Ornamentalen vorziehen, waren fremdartige Ideen für Europäer, wo sich nur die Gutsituierten, die Wohlhabenden, teure Produkte leisten konnten.“

So wurde, meint Gantz, um diesen ungewohnten Prozeß zu beschreiben, eine neue Begrifflichkeit eingeführt und übernommen: „The American System of Manufacture“. Dieses „Amerikanische Herstellungssystem“ führte nach 1900 zu einer neuen Manifestation im „Fordismus“ (Gramsci). Das betrifft den Übergang von der Ersten in die Zweite Industrielle Revolution, zu Verfahrensweisen der Massenproduktion.
Das zweite Kapitel seines Buches, dem Zeitraum 1800-1850 gewidmet, eröffnet Gantz mit der Feststellung: „Amerika begann das Jahrhundert in der Industriellen Revolution weit hinter Europa.“ Damals galt: „England was the primary driver of industrial revolution.“
Interessant, welchen Punkt er dann vorrangig betont: England sei das erste Land gewesen, das die hohe Kindersterblichkeit besiegt habe, die Hälfte seiner anwachsenden Bevölkerung wäre damals unter 15 Jahre alt gewesen, die andere Hälfte damit beschäftigt, „ein globales Wirtschaftsimperium zu erschaffen, basierend auf Produktion, Handel und Rohstoffen aus den Kolonien“.
Das ergibt zugleich Hinweise auf einige Motive der „alten Imperien“, 1914 den Großen Krieg in Kauf zu nehmen, statt Österreich-Ungarn zu drängen, ihren Konflikt mit Serbien als lokal und zeitlich begrenzten Schlagabtausch umzusetzen, quasi als Dritten Balkankrieg jener Ära.
So etwas wie eine schon ineinander verzahnte Weltwirtschaft hatte damals nicht bewirkt, den Ersten Weltkrieg zu vermeiden. Es herrschte ein großer Hunger nach Rohstoffen und neuen Märkten, auch billige Arbeitskräfte spielten dabei gewichtige Rollen. Ich hab in „Herr Turner und die Temeraire“ kürzlich notiert: „Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ziehen allerdings erst Amerika und dann Deutschland mit industriellen Leistungen an England vorbei.“ (link)
Autor Gantz meinte bezüglich „The American System of Manufacture“ im 19. Jahrhundert, die Arbeiter in amerikanischen Fabriken hätten es begrüßt, an solchen Produktionsmethoden mitzuwirken, ganz anders als die europäische Arbeiterschaft. Diese hätte Mechanisierung als eine Bedrohung ihrer Arbeitsplätze empfunden. Gantz verwies an der Stelle auf die Maschinenstürmerei. (Ein Thema, das in den derzeitigen Automatisierungswellen wieder an Augenmerk gewinnt.)
Im „Chapter XI: Of the Spirit in Which the Americans Cultivate the Arts“ erwähnte Tocqueville zu diesem Aspekt, demokratische Völker „will therefore cultivate the arts which serve to render life easy, in preference to those whose object is to adorn it.“ Sie würden „daher die Künste kultivieren, die dazu dienen, das Leben leichter zu machen“ im Kontrast zu jenen Künsten, deren Zweck es ist, sie zu schmücken.
Damit ist übrigens die antike Begrifflichkeit Téchne berührt. Im alten Griechenland wurde noch nicht zwischen Kunst und Technik unterschieden. Im Lateinischen finden sich dann zwei Kategorien, „artes liberales“, die „Freien Künste“, und „artes mechanicae“, die „Praktischen Künste“.
Wir sind heute gewohnt, Kunst und Kunstfertigkeit zu unterscheiden, was sich etwa im Begriffspaar Kunst und Kunsthandwerk ausdrückt. Ich werde bei anderer Gelegenheit noch einmal auf Tocqueville eingehen, denn er schrieb weiters: „But I propose to go further; and after having pointed out this first feature, to sketch several others.“ Das klingt interessant, wenn jenes Jahrhundert weiter auf seine Kontraste zwischen den USA und Europa hin untersucht werden soll.
Was nun Gantz bezüglich des 19. Jahrhunderts mit seinem ausführlichen Verweis auf Tocqueville unterstreicht, bietet uns weitere Denkanstöße. Im Nachdenken über diese bipolare Skizze, über die bevorzugten Produktqualitäten in a) Europa und b) den USA, komme ich auch zu Überlegungen bezüglich Volkskultur und Kunsthandwerk.
Noch einmal Gantz, wie eingangs zitiert: „Das Konzept eines sozialen Wertes aus dem Produktangebot für einfach Leute, statt bloß für die Upper Class … waren fremdartige Ideen für Europäer, wo sich nur die Gutsituierten, die Wohlhabenden teure Produkte leisten konnten.“
Von diesem Kontrast ausgehend finde ich außerdem auch zu Fragen über die Popkultur. Ich bin mit vielem aufgewachsen, das mir Eltern und Lehrerschaft als „Schund“ markiert haben. Das ereignete sich in den 1960er Jahren, als Kategorien wie „Schundhefte“, „Schmutz und Schund“ etc. noch Gewicht hatten und auch Begriffe wie „Negermusik“ im Alltag vorkommen konnten.
Außerdem war die Reizschwelle gegenüber Werken der Gegenwartskunst sehr nieder. Da ergab sich bald dieser oder jener „Skandal“, von dem Polizeieinsätze ausgelöst werden konnten und weshalb Gerichte tätig wurden.
Damals wurden wir privat noch bedenkenlos gezüchtigt. Lange Haare bei Burschen konnten in der Erwachsenenwelt sehr heftige Reaktionen auslösen und „Hochkultur“ wurde zu allerhand „Kulturschande“ in Kontrast gestellt. Die mildeste Form solcher Dichotomien kam als „E und U“ daher, etwa als Ernste Musik und Unterhaltungsmusik.
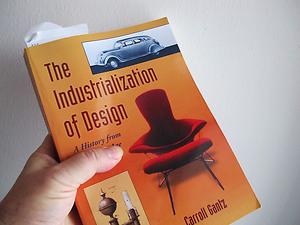
Zugleich war etabliert, was sich bis heute gehalten hat, das Pärchen „Volksmusik“ (als „echte Volksmusik“) und volkstümliche Musik, auch als „volksdümmliche“ Musik denunziert. Was nun „Das Echte“ sei, was „Das Traditionelle“, was dagegen Tand und Schund, all das steht ja nach wie vor zur Debatte.
Die Industrialisierung hat nicht bloß vielfältige Arten der Massenproduktion von Gütern hervorgebracht, wir kennen längst auch eine Unterhaltungsindustrie und eine Freizeitindustrie, also umsatzstarke Kräftespiele, in denen immer wieder die Frage auftaucht, was denn nun „Das Echte“ sei.
Dabei ist über Jahrzehnte so viel an Propaganda entfacht worden, daß wir heute erst wieder fragen müssen, was die Kriterien seien, um Schund von Qualität zu unterscheiden, egal, ob es um Gebrauchsgegenstände oder Kulturgüter geht. Vieles aus dem 20. Jahrhundert ist offenbar noch nicht hinreichend kanonisiert, um solche Fragen abklingen zu lassen. (Nehmen sie als Beispiel bloß Debatten um die 2016er Nobelpreisverleihung an den Singer/Songwriter Bob Dylan.)
Gebrauchswert, Tauschwert, symbolisches Kapital, unsere Alltagsbewältigung und unsere kulturellen Bedürfnisse scheinen stets miteinander verzahnt zu sein. Das drückt sich dann auch entsprechend in sozialen und ökonomischen Phänomenen aus, während wir in unserem Projekt „Mensch und Maschine“ diese Zusammenhänge zwar beachten, aber den Fokus stark auf kulturelle Aspekte einstellen.
Solche Themen-Schnittpunkte finde ich dann auch in der UNESCO-Studie „Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich“ (Heidrun Bichler-Ripfel, Roman Sandgruber und Maria Walcher) aus dem Jahr 2016: (link)
Da heißt es an einer Stelle: „Handwerk, das sich nicht mehr entwickelt, stirbt aus und behält bestenfalls musealen Charakter.“ Daraus folgt: „Traditionelles Handwerk ist lebendiges Handwerk, wenn das aktive Tradieren die Dynamik der Veränderung einschließt.“

Das werte ich übrigens als ein gewichtiges kulturpolitisches Statement: „…wenn das aktive Tradieren die Dynamik der Veränderung einschließt.“
In dieser Studie ist der Traditionsbegriff explizit an der britischen Kultur orientiert, am Ausdruck „transmitted culture“. Das meint „dezidiert den lebendigen Prozess des Tradierens, der Weitergabe von Können und Wissen bei gleichzeitiger Überprüfung auf die gegenwärtige Gültigkeit und Zukunftsfähigkeit“. (Zukunftsfähigkeit!)
Um es noch einmal zu betonen, das sind unter anderem auch kulturpolitisch relevante Aussagen.
Ich hoffe, damit konnte ich ein wenig anschaulicher machen, warum Hermann Maurer und ich nun darangegangen sind, solche Reflexionen zu bündeln und auf die letzten rund 200 Jahre der Steiermark anzuwenden, um dabei ein paar Klarheiten zu gewinnen, die uns auf dem derzeitigen Weg in die Vierte Industrielle Revolution nützen sollen.
Das hat eine Zielsetzung in laufender Projektarbeit, die steiermarkweit Relevanz gewinnen möge, auch darüber hinaus. Das hat ferner spezielle Bezugspunkte im Projekt „Dorf 4.0“, wo ich bemüht bin, ein Beispiel regionaler Wissens- und Kulturarbeit voranzubringen, die sich als kollektive Praxis bewährt und in der Oststeiermark exemplarisch erprobt wird.