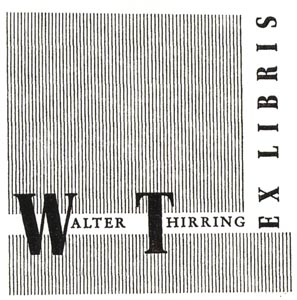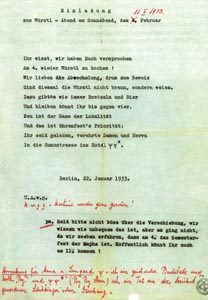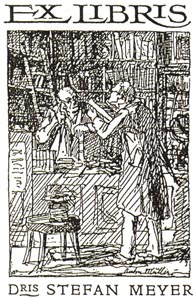Oral History in Science#
Die Österreichische Zentralbibliothek für Physik ist ein Ort internationaler Begegnung. Hier gehen seit Jahrzehnten international renommierte Naturwissenschaftler und Mathematiker, aber auch Historiker und Wissenschaftstheoretiker aus allen Ländern der Welt ein und aus und versorgen sich mit Fachwissen. Darüber hinaus stellt diese Institution, die heute nicht nur Bibliothek im klassischen Sinne, sondern zusätzlich auch noch Phonothek und Videothek modernster Prägung ist, eine Stätte dar, in der Wissenschaftler aller Disziplinen auch gern miteinander plaudern: über Persönliches, Anekdotisches, aber auch über „Gott und die Welt".
Zahlreiche bedeutende Wissenschaftler haben hier schon über sich und ihre Arbeit berichtet und sich dabei oft auch in durchaus humoristischer Weise offenbart. Derartige anekdotengeladene Gespräche wurden und werden gern aufgezeichnet, stellen sie doch für eine wissenschaftshistorisch interessierte Nachwelt eine reiche Fundgrube zur Erforschung interner und externer Faktoren der Wissenschaftsentwicklung dar. Diese Aufgabe des systematischen Dokumentierens und Spurensicherns im Sinne einer naturwissenschaftlichen „Oral History" ist ein Spezialgebiet der Zentralbibliothek, auf dem sie weltweit zu den führenden Institutionen gehört. Die so entstandenen Tondokumente ruhen sorgfältig gelagert in einem eigenen Archiv und warten auf ihre wissenschaftshistorische Aufarbeitung, z. B. im Rahmen von Buchveröffentlichungen, Vorträgen oder Radio- und Fernsehsendungen. Wie man weiß, sind viele Wissenschaftler eher zurückhaltende Menschen. Dies erschwert das freie, lockere Gespräch aber meist nur in der Anfangsphase. Mit Einfühlungsvermögen und einigen psychologischen Kniffen, unterstützt durch eine geschickt arrangierte Kaffee-und-Kuchen-Atmosphäre, gelang es den Interviewern zumeist auch in hartnäckigeren Fällen, die Schweigsamkeit ihrer Gesprächspartner zu durchdringen. Merkwürdigerweise öffneten sich im späteren Verlauf oft gerade jene am meisten, die anfangs die größten Schweiger waren: Berta Karlik und Friedrich Hernegger sind dafür wohl die besten Beispiele, wie im Bandarchiv der Zentralbibliothek nachzuhören ist. Verantwortlich dafür ist wohl nicht nur ein akzeptables temperatur- und feuchtigkeitsreguliertes Klima, sondern darüber hinaus auch eine menschliche Atmosphäre, die zur freien Entfaltung von Ideen und kreativem Schaffen einlädt.
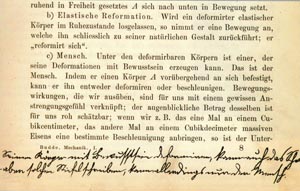
Die moderne Medienwissenschaft lehrt in ihren psychologischen und pädagogischen Erkenntnissen - basierend auf langjährigen praktischen Erfahrungen, die vor allem im angloamerikanischen Raum gewonnen wurden -, dass es bei der Vermittlung schwieriger Inhalte hilfreich ist, Anekdotisches oder Humoristisches in die Gestaltung mit einfließen zu lassen. So kann die Aufmerksamkeit der Leser, Hörer oder Seher nicht nur länger, sondern auch intensiver aufrechterhalten werden, als dies mittels der klassisch-spröden Vortragstechniken möglich ist. In diesem Sinne werden die interviewten Wissenschaftler nicht nur darum gebeten, aus ihrem Leben und über ihre Arbeit zu erzählen; am Schluss der oft sehr tief schürfenden Fachgespräche steht stets ein anekdotisch ausgerichteter Fragenblock.
Da werden dann in bereits stark gelockerter Stimmung eigene und fremde Pannen, Ausrutscher und Missverständnisse zur Sprache gebracht. Oft zeigt sich: Die Welt der Wissenschaft ist reicher an humoristischen Kostbarkeiten und Köstlichkeiten, als viele es dieser zu unrecht als "trocken" eingestuften Materie zutrauen würden. Eine Auswahl zum Schmunzeln aus den gesammelten Interviews soll im Folgenden geboten werden.
6.1 Experimente, die nicht gelingen wollten#
Dass Experimente nicht immer gelingen, liegt in der Natur der Sache. In seltenen Fällen kann das Nicht-Gelingen nicht nur kein Pech, sondern geradezu ein Glück sein. Wie das konkret zu verstehen ist, beschreibt der Physiker Joseph Braunbeck anhand eines merkwürdigen Wasserstoffbomben-Experimentes, das - kaum zu glauben - in Wien stattgefunden hat: „Kurz nach Entdeckung der Kernspaltung hatte man sich überlegt, wo man sonst noch Energie rausbekommen könnte, und da kam man auf den Gedanken, der theoretisch ganz richtig war, dass man durch Fusion von Deuterium-Kernen ebenfalls Energie erzeugen kann. Man muss die Kerne nur entsprechend erhitzen, und dann klappt es. Das stimmt ja auch. Bei der Wasserstoff-Bombe hat man das so gemacht, dass man eine konventionelle Atombombe zum Aufheizen verwendet hat. In Wien wollte man einen anderen Weg gehen [bei einem] Rüstungsauftrag im Jahr 1941. Da sagte man: ,Das werden wir elektrisch zünden' und hat dann Drähte explodieren lassen und Funken in die Deuteriumverbindung hineinknallen lassen. Und der Dr. Hernegger [Friedrich Hernegger, ehemaliger Chef-Chemiker am Wiener Radiuminstitut], der damals als junger Wissenschaftler mit der Durchführung des Experiments betraut war, hat mir noch erzählt, der Institutsvorstand hätte ihm gesagt: ,Gehen's mit die Sachen lieber in den Hof runter, weil wenn das losgeht, dann is' das ganze Labor hin.' Und so durfte Hernegger im Hof des Instituts -etwa dort, wo heute die privilegierten Parkplätze für die Institutsangehörigen sind - auf einer Kiste seine Versuche machen. Es kam nichts dabei raus [...] Das Groteske ist - und das ist wieder einmal ein Stück Herzmanovsky-Orlando: Wenn das wirklich .hochgegangen' war', dann war' der ganze neunten Bezirk weg gewesen und man hätte erst nicht ge-wusst, wie die experimentelle Technik war."
Eine andere, ebenfalls wissenschaftshistorisch gesicherte Begebenheit, die mit dem Misslingen von Experimenten zu tun hat, besitzt einen nahezu mystischen Hintergrund. Sie rankt sich um den aus Wien stammenden Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli. Sein Fachkollege Viktor Weisskopf erklärt, was der Pauli-Effekt ist: „Wann immer Pauli am Institut vorbeiging, ging irgendetwas schief im Institut. Darauf war er in gewisser Weise sogar stolz. Darauf konnte man sich mit Sicherheit verlassen. Aus diesem Grund haben die meisten Experimentalphysiker ihre Experimente nicht am Nachmittag gemacht, denn Pauli kam ja immer nur am Nachmittag ins Institut. In der Früh war man vom Pauli-Effekt geschützt, da gab es keinen Pauli-Effekt. Wir haben einmal versucht, den Pauli-Effekt vorzutäuschen, und zwar so, dass eine kleine Explosion stattfinden sollte, wenn sich der Pauli auf seinen Sitz im Hörsaal setzt. Natürlich - was geschah, war ganz klar: Es war der Pauli-Effekt - und nichts geschah!"
Viktor Weisskopf erzählte im Rahmen des Wiener Internationalen Symposiums anlässlich des hundertsten Geburtstages von Wolfgang Pauli auch eine Geschichte, bei der das eindeutig Falsche, der echte Irrtum im Zentrum steht: „Im Sommer 1934 glaub ich war es, dass Wendel Furry einen Rechenfehler in einer meiner Arbeiten fand. Es war selbstverständlich schrecklich für mich und ich ging zu Pauli und sagte ihm, dass ich nach einer solchen Blamage eigentlich die Physik aufgeben sollte. Und Pauli antwortete mir: ,Das soll man nicht so tragisch nehmen, denn die meisten Physiker haben doch manchmal Dummheiten geschrieben oder gesagt. Ich nie!!!'"
Nun zur Pionierzeit der Radiumforschung: Joseph Braunbeck, Physiker und häufiger Gast der Zentralbibliothek, ist der Autor des Buches „Der strahlende Doppeladler". Er berichtet von Kuriositäten aus diesem Wissenschaftsbereich: „Man hat geglaubt, Radium sei gesund. Da gibt es ein Buch, in dem sogar Berta von Suttner einen Beitrag geschrieben hat. Dieses Buch heißt: ,Die Welt in hundert Jahren'. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hat man gesagt, wenn man erst einmal genug radioaktive Substanzen zur Verfügung hat, dann wird die menschliche Lebenserwartung auf zweihundert Jahre hochschnellen. In diesem Buch ist auch von einem Projekt die Rede, bei dem der Stephansturm mit radioaktiver Leuchtfarbe bestrichen werden sollte, damit man sich in der Umgebung die Straßenbeleuchtung erspart. Allen Ernstes. In der Günthergasse im neunten Bezirk gab es das Geschäft des Herrn Dr. Fischer, da konnte man sich radioaktive Badesalze bzw. Badezusätze, radioaktive Kompressen und auch .Emanatorien' kaufen. Da gab es auch einen amerikanischen Eisenbahnmillionär, den Mister Byas, der hat einfach das Radiumsalz in Wasser aufgelöst und getrunken statt der Emanation. Interessanterweise ist alles in seinem Unterkiefer gelandet. Auf irgendeiner amerikanischen Universität kann man den Unterkiefer des Mister Byas bewundern ... selbstverständlich unter Strahlenschutzvorschriften ..."
Ebenso unbekannt dürfte die Tatsache sein, dass der Sockel des Goethe-Denkmals in Wien eine recht veritable Strahlenquelle darstellt. Besteht er doch aus so genanntem „Uran-Marmor", der zur Zeit unserer Ahnen wegen seines besonders schönen Glanzes hoch geschätzt wurde. Braunbeck: „Das Goethe-Denkmal ist eine Strahlenquelle, die man eigentlich nach dem Strahlenschutzgesetz zulassen müsste. Das strahlt rund zehn Mal so viel wie der Untergrund. Normalerweise haben wir etwa 200 Nanosievert pro Stunde. Das ist der Wert, der in Wien im Durchschnitt existiert. Das Goethedenkmal hat rund den zehnfachen Wert: Etwa ein Mikrosievert pro Stunde. Im Gemeinderat - ich hab das in meinem Buch beschrieben - gab es sogar schon eine Beratung darüber. Ich hatte schon befürchtet, dass das Goethe-Denkmal ein ,schiaches' Warnschild .Vorsicht Strahlung!' kriegt, aber bis heute ist Gott sei Dank noch nicht passiert."
In der Frühzeit der Nuklearphysik und noch bis in die Fünfzigerjahre kümmerte man sich auch am Wiener Radiuminstitut nur wenig um Strahlenschutz. Über Berta Karlik, die dieses angesehene Institut von 1947 bis 1974 leitete, pflegten die Studenten zu sagen: „Die Alte is' ja Hab, aber wenn's ins Labor kommt, dann versaut's uns jede Messung ..."Joseph Braunbeck gegenüber hat sich Berta Karlik noch zur Zeit von Tschernobyl geäußert: „Was machen sich die Leute mit ihren Nano- und Pikocurie Sorgen [...] Ich hab ganze Curie verspeist!"
6.2 Entdeckungen, die keine waren#
Zunächst erscheint vor uns das breite Spektrum jener Entdek-kungen, die das nachweislich nicht im ursprünglichsten Sinn des Wortes waren. Das wohl bedeutendste derartige Ereignis, das keines war, ereignete sich vor knapp hundert Jahren. Die Entdeckung der N-Strahlen ist, wie Herbert Pietschmann berichtet, eine der spektakulärsten Merkwürdigkeiten der Wissenschaftsgeschichte: „Ein gewisser Prof. Blondlot aus Nancy hat tatsächlich Strahlen entdeckt, von denen er gemeint hat, dass sie ihn berühmt machen würden, und die er verfolgt hat. Nachdem Röntgen seine Strahlen X-Strahlen nannte, hat der .seine' Strahlen N-Strahlen genannt; und zwar nach der Stadt Nancy, in der seine Universität war. Ein gewisser Prof. Wood von der Johns Hopkins University in Amerika wollte diese Versuche wiederholen beziehungsweise die Entdeckung Blondlots nachvollziehen, was ihm jedoch nicht gelungen ist. Daher hat er sich nach Nancy begeben (was damals ja gar nicht so einfach war), um im Laboratorium seines Kollegen festzustellen, was er falsch gemacht habe. Diese Versuche wurden natürlich alle im verdunkelten Zimmer gemacht, damit man die Fluoreszenz gesehen hat, und zu seinem großen Erstaunen hat dieser Wood auch im Laboratorium von Blondlots keine Strahlen oder Effekte gesehen, die Blondlots ihm offensichtlich ganz deutlich beschrieben hatte. Dann hat Wood seinem Kollegen im verdunkelten Zimmer ein wesentliches Prisma aus der Apparatur herausgenommen [...] Blondlot hat seine Strahlen aber noch immer gesehen, obwohl das technisch gar nicht mehr möglich war. Seit dieser Zeit weiß man, dass es diese Strahlen gar nicht gibt."
Andererseits hat aber vieles, das ganz unglaublich klingt, durchaus berechtigten Anspruch darauf, ernst genommen zu werden. Wobei das Ernstnehmen im Bereich der theoretischen Physik und der Astrophysik oft schwer fällt, etwa dann, wenn exotische Materie oder Wurmlöcher im Universum ins Spiel gebracht werden - Themen, die zum Beispiel von Peter Aichelburg und Helmuth Urbantke bearbeitet werden. Urbantke: „Also ich würde meinen, dass diese Aspekte vielleicht nicht zu stark betont werden sollten, sonst meinen die Leute, wir beschäftigen uns mit lauter skurrilen Dingen. Das ist nicht der Fall. Wir beschäftigen uns durchaus mit Problemen, die in der Astrophysik und in der Kosmologie von Relevanz sein können." Aichelburg: „Gut, aber wir beschäftigen uns mit einer Theorie, die unter Umständen solch skurrile Dinge ermöglicht, und wir gehen diesen Dingen auch bis zu einem gewissen Grad nach. Ich glaube, du hast vorhin zu Recht betont, dass dies ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit ist, eine Theorie ernst zu nehmen und sie auf ihre Grenzen hin zumindest abzuklopfen."
Bekanntlich suchen Physiker in aller Welt schon seit Jahren mit großer Leidenschaft, aber vergeblich nach dem so genannten Higgs-Teilchen, jenem Teilchen, von dem sie glauben, dass es für die Masse alles im Universum Existierenden verantwortlich ist. Herbert Pietschmann berichtet von einer merkwürdigen Entdeckungsgeschichte, die sich um dieses geheimnisvolle Teilchen rankt: „Vor etlichen Jahren wurde dieses Higgs-Teilchen angeblich gefunden, und zwar nicht auf Grund einer Fehlinterpretation eines Experimentes, auch nicht auf Grund irgendeiner Fälschung oder einer Täuschung, sondern ganz klar als statistischer Effekt, der jenseits jedes Zweifels war. Es wurde darüber auch viel in verschiedenen internationalen Konferenzen gesprochen. Allerdings hat es sich dann - als man das Experiment weiterführte -herausgestellt, dass genau an jener Stelle, wo sich das ursprüngliche Higgs-Teilchen angekündigt hatte, auf Grund einer Häufung von Ereignissen ein Defizit von Ereignissen war. Als man die Experimente zusammenführte, hat sich eine völlig glatte Kurve ergeben, das heißt, es war nichts. Die Physiker sprechen dabei von einer statistischen Fluktuation."
Wie die meisten Wissenschaften, so tritt auch die Physik da und dort als Hilfswissenschaft auf. Wie der Chemiker Franz Mairinger berichtet, kam es vor einigen Jahren zu einer ganz besonderen Merkwürdigkeit, als Archäologen ihre Kollegen von der Physik baten, ihnen bei der Altersbestimmung einer sehr wertvollen Münze zu helfen. „Man hat die Münze in die Neutronen-Bestrahlungskammer eines Reaktors gelegt und hat sich dann die künstlich radioaktiv gemachten Elemente angesehen. Nur hat man aus Versehen eine etwas zu hohe Dosis erwischt. Das heißt, die Münze wurde den Archäologen in einem Bleibehälter unversehrt zurückgegeben, jedoch mit der Auflage, den Bleibehälter zehn Jahre lang nicht zu öffnen. Erst nach Ablauf dieser Frist sei die Radioaktivität so weit abgeklungen, dass nichts mehr passieren könne." Hier kann man allerdings noch von Glück sprechen, sind doch in der Kernphysik auch Halbwertszeiten von der Dauer einer halben Ewigkeit keine Seltenheit.
,Pannen haben auch insofern ihr Gutes, als man aus ihnen lernen kann. So lernten zum Beispiel österreichische Blitzforscher viel aus einem Problem, das sie mit einem Blitzfrühwarnsystem hatten. Dieses Problem bestand, wie Gerhard Diendorfer berichtet, darin, dass der Blitz in das System einschlug und es total zerstörte: „Das Grundproblem ist ja, dass ein Gewitter erst einmal aktiv werden muss, damit es überhaupt eine Warnung geben kann [...] Die Zukunft wird zeigen, ob es irgendetwas gibt, dass man Gewittervorwarnung so betreiben kann, dass man die Blitze schon erkennt, bevor sie entstehen." Der dazu nötige Geistesblitz ist zur Zeit noch ausständig.
Nun zum Gebiet der wissenschaftlichtechnischen Tatsachen - und seien das auch handfeste Kuriositäten, die nur merkwürdig erscheinen. Durchaus ernst zu nehmen war eine bis heute unbekannte Entwicklung des österreichischen Erfinders Josef Sliskovic, die ihm Ende der Fünfzigerjahre geglückt war. Der Physiker und Technikhistoriker Joseph Braunbeck erklärt die Funktion dieses Transistorradios, das erst zu spielen begann, wenn man es in den Mund steckte: „Dieses Radio hatte als Stromquelle ein kleines Elektrodenpaar, eine Art Lollipop, einen ,Kojak-Empfänger'. Man steckte den Lollipop in den Mund, und weil der Speichel Salzsäure enthält, bildeten die beiden Metalle ein galvanisches Element. Die entstehende Spannung genügte zum Betriebe des Empfangsteils, der im Vorderteil des Radios untergebracht war. Für diesen Empfänger interessierte sich damals die US Army. Man hatte die Idee, vielleicht könnte man die Funkgeräte der Armee nach dieser Methode batterieunabhängig machen; nicht aus Gründen des Umweltschutzes, sondern aus Gründen des Nachschubes, sodass der Gl, wenn er funken muss, die Verpackung des Lollipop abreißt, ihn in den Mund steckt - und funkt." Unnötig zu sagen, dass dieser Traum der US Army nicht in Erfüllung ging.
Heute ist immer öfter vom „Teufelszeug Elektronik" die Rede. Das mag unter anderem mit der großen Sensibilität moderner Halbleiterchips zusammenhängen. Schon vor rund drei Jahrzehnten wurde entdeckt, dass verschiedene nukleare Phänomene einen elektromagnetischen Impuls bewirken, der die Zerstörung elektronischer Schaltungen zur Folge haben kann. Dieser elektrische Schock, der wie ein Stromstoß wirkt, kann in ganzen Landstrichen sämtliche Computer sowie alle anderen elektronischen Einrichtungen lahmlegen, wie Joseph Braunbeck erklärt: „Die Amerikaner haben diesen ,electro-magnetic pulse' zunächst gar nicht so sehr beachtet, bis ihnen eines Tages durch einen Deserteur eine MiG in die Hände gefallen ist. Da haben sich die Amis krumm und schief gelacht, weil in den Funkgeräten Röhren drin waren. Bald darauf wurden sie mit dem Problem des ,electromagnetic pulse' konfrontiert, und da haben sie dann nicht mehr gelacht. Daraufhin wollten sie einen bereits höchst betagten neunzigjährigen Wissenschaftler und Techniker, einen einstmals führenden Röhrenspezialisten, in die USA holen, damit er wieder ein paar Technikern beibringt, wie man Kathoden macht. Diese ,Kunst' war inzwischen schon fast völlig verloren gegangen. Der alte Herr hat mir damals gesagt: ,Wissen's, wenn ich noch achtzig war, dann würd ich das ja machen ... aber so mag ich das nicht mehr!'
6.3 Dinge gibt's, die gibt's gar nicht#
Was es nicht alles gibt, das es nicht gibt, illustriert eine wieder wahre Geschichte aus dem Reich der physikalischen Chemie. Zu Beginn der 1960er Jahre glaubten russische Forscher, Wasser polymerisieren zu können, also Wasser herstellen zu können, bei dem sich die Moleküle in ähnlicher Weise ineinander verhaken, wie das bei Äthylen der Fall ist. Braunbeck beschreibt, auf welche Weise Nikolai Fedjakin die Herstellung von „Polywasser" gelungen sein soll: „Das ,gelang' durch einen Kunstgriff. Fedjakin ließ Wasser in ganz engen Röhrchen aus der dampfförmigen Phase wieder in die flüssige Phase kondensieren. Dann bildete sich nicht normales flüssiges Wasser, sondern .Polywasser'. Und dieses ,Polywasser', das man sodann in winzigsten Mengen in den Kapillaren hatte, hatte ganz merkwürdige Eigenschaften: Der Siedepunkt war bei 150 Grad Celsius. Es war auch rund eineinhalb Mal so schwer wie gewöhnliches Wasser. Dieses ,Polywasser' blieb zuerst auf die Sowjetunion beschränkt. Eines Tages hielt einer der beteiligten Forscher ein Referat bei einer internationalen Tagung in Großbritannien. Und da war der amerikanische Marine-Attache anwesend. Kurze Zeit später wurde gleich eine richtige James-Bond-Geschichte draus: Der Attache berichtete seinen Landsleuten sofort von der Neuigkeit, die Russen hätten da was Neues und man dürfe sich keineswegs abhängen lassen. Das führte nun wiederum dazu, dass die Amerikaner eifrigst mit ,Polywasser' zu forschen begannen, um die Russen zu überholen. Die US-Forscher glaubten zum Schluss sogar, Varianten hergestellt zu haben, die bis zu 1200 Grad Celsius temperaturbeständig sind, glaubten also, .gehärtetes Polywasser' hergestellt zu haben. Das Ganze war höchst geheim. Zuerst war's öffentlich - dann war's geheim. So blieb weitgehend auch geheim, dass ein vorwitziger amerikanischer Forscher draufkam, was es damit auf sich hatte: Die Kapillaren konnte man nicht sorgfältig genug reinigen [...] Und das ,Polywasser' war schlicht und einfach verunreinigtes (ganz normales) Wasser!"
Nun zu einem noch weitaus mystischeren Wissenschaftsthema aus der geheimnisvollen Welt der Strahlen. In Kyoto in Japan saß einst ein Herr namens Muruoka. Dieser Herr Muruoka meinte, wenn grün leuchtende Uransalze (das war kurz nach der Entdeckung der Radioaktivität) Strahlung aussenden, dann müssten jene Glühwürmchen im Tempelpark von Kyoto, die mit üchtsignalen ihre Partner anlocken, vielleicht auch so etwas wie Röntgenstrahlen aussenden. Muruoka machte sich ans Werk und sperrte eine Unmenge von Glühwürmchen in eine Schachtel. Diese Schachtel war, wie Braunbeck zu berichten weiß, seine „Strahlenquelle": „Da maß er dann nicht nur die Absorption der Glühwürmchenstrahlen, sondern sogar den Brechnungsindex diverser Substanzen für die Glühwürmchenstrahlen, den man für die Röntgenstrahlen damals noch nicht gemessen hatte, weil er sich ja nur unwesentlich von 1 unterscheidet. Muruoka war insofern schlau, dass er sich gegen die Konkurrenz insofern abgesichert hatte, indem er behauptete, von anderen Glühwürmchenrassen wisse er zwar nichts, aber bei seinen Messungen ging es ausschließlich und speziell um die Glühwürmchenstrahlung jener Glühwürmchen aus dem Tempelpark von Kyoto. Damals waren die Forschungsinstitute noch nicht so reich dotiert wie heute. Die Reise nach Japan war teuer wie mühsam, wodurch es eine ganze Weile dauerte, bis die Sache mit den Glühwürchenstrahlen in Vergessenheit geriet. Entlarvt wurde Muruoka nie!"
Mit merkwürdigen Strahlungsphänomenen befasste sich auch ein Wiener Chemiker namens Karl Ludwig Freiherr von Reichenbach. Er wurde durch die Entdeckung des Paraffins reich, bewohnte das Schloss Kobenzl und experimentierte dort in bereits sehr reifen Jahren mit seinen geheimnisvollen Od-Strahlen. Das Öd war nach Reichenbach eine Strahlung, die angeblich von allen möglichen Substanzen und auch von Lebewesen ausging und als schwaches Leuchten vom ausgeruhten Auge wahrgenommen werden konnte. Reichenbach hatte die Empfindlichkeit seiner Augen durch intensives Training nahezu ins Unermessliche gesteigert. Einmal soll er sogar vier Tage in völliger Dunkelheit zugebracht haben.
„Wie wir heute wissen und wie man es auch selbst ausprobieren kann - vorausgesetzt man hat die Geduld dazu, - wenn man einmal nur zwei Stunden lang im Dunkeln sitzt, dann sieht man allerhand [...] Denn dann spielt der Sehnerv verrückt [...] Und da hat Reichenbach nicht nur mit sich selbst experimentiert, sondern da hat er die .Erscheinungen' auch etliche Versuchspersonen sehen lassen. Wenn ein Skeptiker gesagt hat: ,lch seh nichts!', dann antwortete er ihm: ,Sie sind eben nicht sensitiv!'" Es handelte sich also bei Reichenbach und seinen Od-Strahlen um das genaue Gegenteil von exakter Wissenschaft, wie wir sie heute schätzen. Wie auch immer: Reichenbach war mit seinen Od-Strahlen ganz glücklich, und das ist ihm auch im Nachhinein noch zu gönnen. Wenn Besucher kamen, schilderten sie, dass er, wenn er in seinem stockfinsteren Keller experimentierte, ein Gewand trug, das ihn wie Goethes Faust erscheinen ließ. In mondlosen Nächten soll er mit Begeisterung und großer Regelmäßigkeit auch die nahen Friedhöfe aufgesucht und behauptet haben, an der Od-Strahlung könne er die frischen Gräber erkennen.
6.4 Fragen, Fragen und nochmals Fragen#
Nun zum Komplex jener Fragen, die uns schon lange plagen, und jenen, die uns bis jetzt erspart geblieben sind. Ein Problem, das, wenn überhaupt, erst in fernster Zukunft auf uns zukommen wird, uns aber schon jetzt bewegt, ist die Frage nach der Stabilität unseres Planetensystems. Diese Frage ist zum Beispiel für Edmund Hlawka, einen der bedeutendsten österreichischen Grundlagen-Mathematiker, von besonderem Interesse: „Kann das Planetensystem chaotisch werden? Das würde bedeuten, dass alle unsere Kalender wegzuwerfen sind und kein Kalender mehr sinnvoll anzuwenden ist. Wenn die Planeten zu spinnen anfangen, wäre das schon deshalb nicht wünschenswert, weil dann vielleicht der erste Jänner auf den dreizehnten Jänner fällt. Und da wäre dann der Neujahrstag ein Unglückstag. Das könnte passieren. Spaß beiseite: Man hat Vermutungen, da sind große Artikel auch in den Sitzungsberichten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erschienen, dass der Rand des Planetensystems schon leicht chaotisch zu schwanken beginnt. Die Vermutung, die unter anderem von Moser in Zürich vertreten wird und die auch von allen bisher durchgeführten Computersimulationen bestätigt wird, weist darauf hin, dass unser Planetensystem nicht stabil ist, obwohl Laplace behauptet hatte, er hätte einen Beweis für die Stabilität. Jedenfalls müssen wir damit rechnen, dass wir eines Tages - noch lange bevor die Sonne erkaltet - ins Weltall hinausgeschleudert werden. Aber eine Zeit lang können wir unsere Kalender, auch den ,ewigen Kalender' noch benützen." Ebenso wissenschaftlich zwingend lässt sich die Frage beantworten, was passiert wäre, wenn der Jupiter nur ein bisschen größer wäre, als er tatsächlich ist. Für den Astrophysiker Ernst Dorfi ist die Beantwortung dieser Frage sehr einfach: „Wenn er größer geworden wäre, als er tatsächlich ist, dann hätte es sein können, dass auch beim Jupiter Kernreaktionen stattfinden. Dann hätten wir ein Doppelsternsystem, besäßen demnach zwei Sonnen. Allerdings wäre dann das Problem aufgetreten, dass die Planetenbahnen hochgradig instabil wären. Instabil bedeutet, dass sich kleine Störungen aufschaukeln und der Planet verhältnismäßig rasch aus der Bahn geworfen wird."
Nun zu einem Fragenkomplex, der zunächst nur grundlagentheoretische Bedeutung zu haben scheint, jedoch auch von praktisch-philosophischer Relevanz sein kann: Seit langem schon arbeiten Astronomen, Astrophysiker und Kosmologen an der Erforschung schwarzer Löcher im Kosmos. Da solche Löcher alles verschlingen, was ihnen zu nahe kommt, stellt sich nun die höchst ernsthafte Frage: Gehört der Rand des schwarzen Loches schon zur Umgebung oder noch zum „Loch an sich"? Zunächst sucht der Astronom Ernst Göbel nach einer einleuchtenden Antwort: Göbel: „Der Rand gehört eigentlich zum schwarzen Loch, kann man sagen. Der Rand definiert den Bereich des schwarzen Loches, dort endet der Wirkungsbereich des schwarzen Loches." Interviewer: „Das beantwortet aber noch nicht ganz die ursprüngliche Frage [...] Vergleichen wir zunächst ein schwarzes Loch mit einem ,normalen' Loch." Göbel: „Das ist schwierig [...] Was ist ein normales Loch? Es ist definiert als Einbruch in die Materie zum Beispiel [...] und dort begrenzt, wo die Materie wieder beginnt. Hier ist also der Rand wieder irgendwie definiert. Das ist sicherlich die Grenze zwischen dem Loch und der Umgebung, die dort beginnt. Aber definitionsgemäß bin ich schon der Meinung, der Rand ist mehr Bestandteil der Begrenzung des Loches und definiert damit das Loch an sich, also allgemein das Loch." Der Physiker und Erkenntnistheoretiker Herbert Pietschmann versucht, das Problem des Lochrandes philosophisch zu bewältigen: Pietschmann: „Die Grenze ist zugleich etwas und nichts und beides kann man beweisen. Die Grenze muss etwas sein, denn wenn die Grenze nichts wäre, dann gäbe es ja keine Grenze, dann wäre ja alles unbegrenzt. Die Grenze darf aber nichts sein, denn wenn sie etwas wäre, dann gehört sie entweder zum Körper oder zum Nicht-Körper und ist selber nicht die Grenze, dann gäbe es eine Grenze zwischen dem Körper und der Grenze und so weiter. Nun, ich darf gleich sagen, dass diese Aporie, so wie einige andere Aporien in der modernen Physik, tatsächlich gelöst wurde, und zwar von der Quantenmechanik. Diese Theorie sagt ja in ihrem Welle-Teilchen-Formalismus, dass sozusagen die kleinsten Typen von Körpern, nämlich die Elementarteilchen, eben zugleich begrenzt und unbegrenzt sind, weil sie zugleich Wellen- und Teilchencharakter haben. Von den Teilchen kann man genau sagen, wie groß sie sind; zugleich haben sie aber auch Wellencharakter, das heißt Kontinuumscharakter, von dem man nicht sagen kann, wo er aufhört. Das heißt, diese Aporie wurde tatsächlich in der Quantenmechanik gelöst."
Mindestens ebenso verzwickt wie das Problem des Loches und seiner Grenzen und der Grenzen ganz allgemein ist die Frage nach dem Wesen des Punktes, der für den Mathematiker Edmund Hlawka zugleich etwas und nichts ist: „Was kann das sein? Einen Punkt kann man ja nicht zeichnen, denn wenn man ihn zeichnet, dann ist's ein Kreidefleck oder ein Tintenfleck. Ein Punkt ist, der nichts ist. In meiner Mittelschule hat man gesagt, ein Punkt ist, was übrig bleibt, wenn ich einem Zirkel die Schenkel ausreiße. Ernsthafter ist die Definition: Ein Punkt ist, was keine Teile hat." Dass ein Punkt ein Nichts ist, hat Hlawka ebenso knapp wie ein-leuchtend gezeigt. Und er hat damit das We-sen des Punktes, der eigentlich ein NichtSeiendes ist, sozusagen „auf den Punkt gebracht". Hlawka: „Ja, das ist der springende Punkt!"
Mindestens ebenso problematisch wie der Begriff des Punktes ist der des Sprunges. Mit seinem Wesen hat sich der von Naturwissenschaftlern selten geliebte Philosoph Martin Heidegger eingehend befasst. Der Heidelberger Philosoph Hans Albert hat Heideggers Definition ausgegraben - eine, die gewiss nur wenige unter uns glücklich macht: ,„Der Sprung ist der Satz aus dem Grundsatz vom Grunde in das Sagen des Seins.' Mumpitz ist das! Musica dei vocabuli! Das stammt von Pareto, dem berühmten Ideologiekritiker. Der hat das ,Wortmusik' genannt. Ich hab das alles genau analysiert. Ich sage das nicht nur so [...] ich hab das analysiert!" Der Punkt - ein Nicht-Seiendes - kann also ganz grundsätzlich nichts Sprunghaftes an sich haben. Egal, wie man die Begriffe im Einzelnen bewerten mag.
6.5 „Wenn zwei Weise einander begegnen, gibt es ein grosses Lachen!"#
Der Laie könnte meinen, dass Wissenschaftler andauernd nur denken und grübeln. Das ist aber keineswegs der Fall. Herbert Pietschmann hat dazu einen historischen Beleg: „Als Viktor Weisskopf als ganz junger Mann nach Kopenhagen kam, war er ganz aufgeregt, die Entwicklungen, die das Atom und sein Inneres enthüllten, miterleben zu dürfen, und war zunächst überrascht, dass die Physiker dort viel mehr gelacht haben als gegrübelt. Und ein etwas älterer Kollege - es war Gamow - hat ihm damals gesagt: ,Es gibt Dinge, die sind so ernst, dass man sie nur mit Humor behandeln kann!'"
Zum Abschluss noch zu einer Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, wie es zunächst scheinen mag. Die so genannte „Spiegelfrage", mit der in den Interviews Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen konfrontiert wurden, ist imstande, jeden, der sie noch nicht kennt, zu verwirren. Sie lässt sich in der einfachsten Form so stellen: Der Spiegel vertauscht doch links und rechts, warum aber vertauscht er nicht oben und unten? Der Physiker Wilhelm Bibl antwortete darauf: „Ihre Frage ist durchaus berechtigt [...] Der Spiegel vertauscht links und rechts, warum aber vertauscht er nicht oben und unten? Da bin ich jetzt im Augenblick überfragt." Der Logistiker und Mediziner Curt Christian sagte nach längerem Grübeln: „Es ist ja so, dass es zu einer Kreuzung kommt; vom rechten Gesichtsfeld wird projiziert auf die linken Netzhauthälften. Die projizieren dann in die linke Hirnhäfte. Rechts - links - links, nicht wahr? Rechtes Gesichtsfeld, linke Netzhauthälften beider Augen in das linke Gehirn. Es hängt also mit der Struktur der Sehnervkreuzung zusammen, dem chiasma opticum, fasciculorum oder jetzt sagt man chiasma, spricht man nicht so nach der Jenaer Nomenklatur von einem fasciculus opticus, sondern wieder von einem nervus opticus." Interviewer: „Also jedenfalls rechts - links - links - rechts -rechts - links, aber nicht oben und unten?" Christian: „Rechts - links - links - links - rechts - rechts, nicht wahr? So kann man sich das merken. Würde das auch in zwei Ebenen sein, die Kreuzungen, dann würde man auch oben - unten vertauscht sehen." Interviewer: „Wir würden also kopfstehen?" Christian: „Wir würden kopfstehen, ja." Interviewer: „Wäre dann nicht noch theoretisch die Möglichkeit, den Spiegel umzudrehen?"
Nun ein kurzer Blick ins Reich des freiwilligen Humors innerhalb der Wissenschaft. Im Zentrum der folgenden interdisziplinären Geschichte, die Herbert Pietschmann erzählt, stehen ein Astronom, ein Physiker und ein Mathematiker, „... die gemeinsam eine Urlaubsreise in Schottland machen. Und sie fahren dort mit der Bahn, sehen aus dem Abteil und erblicken ein schwarzes Schaf. Daraufhin sagt der Astronom: ,Jö, schaut's, in Schottland sind die Schafe schwarz.' Daraufhin sagt der Physiker: ,Na, das kannst nicht sagen, sondern du musst sagen: In Schottland gibt es mindestens ein schwarzes Schaf.' Daraufhin der Mathematiker: ,Auch das kannst du nicht sagen, denn korrekt muss es heißen: In Schottland gibt es mindestens ein Schaf, das mindestens auf einer Seite schwarz ist.'" Womit wir - endlich - in den hoch liegenden Grenzregionen der Philosophie angelangt wären. Je höher wir hinaufsteigen, umso näher kommen wir bekanntlich dem „Ding an sich". Dem mathematischen Logiker Gurt Christian wurde deshalb die ebenso schwer wiegende wie kecke Frage gestellt: „Was hat so ein Ding an sich?" „Ja, das ,Ding an sich' wäre eigentlich im Kant'schen Sinne so zu erklären: Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist [...] Man kann sich das so vorstellen, dass dieselben Sätze, die ich hier für meine Erscheinungswelt zur Anwendung bringe, auch in der ,Welt an sich' gelten. Ich weiß nur nicht, wie die Interpretationen sind. Das ,Ding an sich' wäre eigentlich dahingehend zu verbessern, indem man von der ,Welt an sich' spricht."
Nun fragt sich, in welchem Verhältnis eigentlich die ideale Welt mit ihren Theorien und Hypothesen zur realen Welt steht. Was die Beziehung zwischen Mathematik und Wirklichkeit betrifft, so zitiert Hlawka immer wieder Einstein: „Soweit sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher und soweit sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit." Lichtenberg bemerkte zu diesem Themenkreis nicht ganz zu Unrecht: „Es gibt viel zwischen Himmel und Erde, wovon sich unsere Wissenschaft nichts träumen lässt. Aber leider gibt es noch viel mehr in der Wissenschaft, wovon sich weder im Himmel, noch auf der Erde etwas findet, weil das Konstruktionen des Menschen sind."
Beispiele für Dinge, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, gibt es genug. Der Punkt, der wie ausführlich gezeigt wurde, in Wirklichkeit nur im Kopf existiert, ist wohl das einleuchtendste Beispiel. Die Frage, ob es auch Teilchen - kleine Teilchen -gibt, die nur im Kopf des Wissenschaftlers existieren, lässt sich nicht ohne weiteres beantworten. Die Physiker, wie zum Beispiel Ernst Dorfi, kennen so genannte „virtuelle" d. h. scheinbare Teilchen: „Ja, nur das sind eben in dem Sinn keine Teilchen, die man direkt misst, sondern eben virtuelle Teilchen [...] Ich tu' mir jetzt schwer, das zu erklären. Das misst man zum Beispiel mit Hilfe des ,Casimir-Effektes'. Ich verhindere, dass alle Arten von Teilchen von virtuellen Teilchen erzeugt werden, sondern nur mehr eine bestimmte Art. Oder anders ausgedrückt: Ich schließe eine bestimmte Art von Teilchen aus. Das heißt, ich erlaube nicht mehr alle Schwankungen, sondern nur mehr einen Teil der Schwankungen. Das heißt, es gibt dann ein Raumgebiet, in dem alles erlaubt ist an virtuellen Teilchen, und es gibt eines, in dem nicht mehr alles erlaubt ist." Interviewer: „Und was macht das Universum, wenn es keine Physiker gibt, die ihm irgendetwas verbieten?" Dorfi: „Das Universum ist wahrscheinlich unbeeindruckt davon, ob es Physiker gibt, die ihm etwas erlauben oder nicht [...] Das läuft einfach ab."
6.6 Sprichwörtliche Weltfremdheit?#
Es gibt unzählige Anekdoten, bei denen die sprichwörtliche Vergesslich-keit und Geistesabwesenheit der Wissenschaftler eine Rolle spielt. Das beginnt bei jenen Geschichten, in denen die Frauen von Akademiemitgliedern - auch in Österreich - ihren Männern Namenstäfelchen in Mäntel und Hüte eingenäht haben, da es nach jeder Akademiesitzung zum Vertauschen von Mänteln und Hüten gekommen ist. Der Physiker Wolfgang Kummer berichtet von einer Geschichte, bei der es um einen Kollegen geht, dessen Name vielleicht doch besser im Dunkeln bleiben soll: „Der Wissenschaftler und seine Frau hatten Gäste, und seine Frau hat plötzlich zu ihrem Mann gesagt: ,Du musst unbedingt die Krawatte wechseln. Da ist ein hässlicher Fleck drauf [...] schnell, bevor die Gäste kommen!' Da ist er verschwunden und ins Schlafzimmer gegangen und ist aber nicht mehr zurückgekommen. Mittlerweile sind die Gäste eingetroffen. Und die Frau wunderte sich, wo ihr Mann steckt. Da ging sie ins Schlafzimmer und sah, dass er mit dem Nachthemd bekleidet im Bett gelegen ist und fest eingeschlafen war. Es hat sich dann herausgestellt, dass er in jenem Moment, da er die Krawatte abgelegt hat, damit begonnen hat, sich komplett auszuziehen und sich dann schließlich, wie er's gewohnt war, ins Bett gelegt hat und eingeschlafen ist."
Eine gewisse Weltfremdheit kann - wie tausendfach zu belegen ist-Wissenschaftlern vieler Fachrichtungen zugeordnet werden, wobei der Grad der Schrulligkeit mit dem Grad fachlicher Abstraktion zu wachsen scheint. Herbert Pietschmann illustriert das anhand einer Anekdote über den wohl bekanntesten zeitgenössischen österreichischen Mathematiker Edmund Hlawka, der gewohnt war, den Inhalt einer zweistündigen Vorlesung auf einem einzigen Straßenbahnfahrschein festzuhalten: „Edmund Hlawka - ich war damals selbst in seiner Vorlesung - hat von seinem Fahrschein die Angabe für seine Rechnung abgeschrieben. Und da kam dann auf der rechten Seite der Gleichung heraus: = r - und dann wäre die Hochzahl gekommen. Und Hlawka sagte: ,Zu dumm, jetzt hat mir die Schaffnerin doch tatsächlich die Potenz weggezwickt!'"
Es gehört zum Wesen der Wissenschaft und ihrer Methode, dass sie bestimmte Seinsbereiche außer Acht lässt. Dies könnte auch mit ein Grund dafür sein, dass dem Laien manche Wissenschaftler mitunter eigenartig erscheinen. Die Vermutung, der Grad der Weltfremdheit hänge direkt mit dem Grad des Abstraktionsniveaus zusammen, hat trotzdem etwas für sich. Kummer illustriert das am Beispiel des österreichischen Physiknobelpreisträgers Wolfgang Pauli: „Weisskopf hat mir erzählt, dass Pauli ein sehr schlechter Autofahrer war und insbesondere das Linksabbiegen als große Herausforderung betrachtet hat, die er möglichst vermieden hat. Er hat sich daher in seinem Schweizer Institut einen Weg zurechtgelegt, dass er immer nur rechts abbiegen musste, wenn er von seiner Wohnung ins Institut gefahren ist. Bekanntlich ist es so, dass man, wenn man zweimal rechts abbiegt und eine Schleife macht, dann auch ans Ziel kommt. Er ist also nur mit Rechtsabbiegen in sein Institut gefahren. Und ebenso ist er nur mit Rechtsabbiegen von seinem Institut wieder zurück nach Hause gefahren."
Merkwürdiges spielte sich ab und zu auch im Kopf des berühmten Physikers Ludwig Boltzmann ab. Sein Fachkollege Wolfgang Kummer kennt ein Fallbeispiel, das mit Boltzmanns Streben nach natürlicher Lebensweise zusammenhängt: „Er hat sich eingebildet, dass er im Milchgeschäft keine gute Milch kriegt. Daher ging er einmal in Graz auf den Markt und kaufte sich eine Kuh. Und der Herr Professor persönlich führte diese Kuh an einem Strick durch die Altstadt von Graz in den Garten seines Hauses und hat sie dort angebunden. Er hatte sich aber nicht überlegt, wie man aus dieser Kuh die Milch herauskriegt. Und es bedurfte einiger Anstrengungen seitens seiner Mitarbeiter, diese Kuh wieder zu verkaufen." Der Astrophysiker Ernst Göbel meint dazu: „Man wird tatsächlich - im wahrsten Sinne des Wortes - wenn man sich intensiv mit theoretischen Fragen beschäftigt, weltfremd. Man muss es eigentlich werden. Und natürlich - wir brauchen sicherlich auch als Menschen immer wieder irgend einen Bezugspunkt, einen Orientierungspunkt, einen ruhenden Pol. Und gerade wenn man sich auf diesem Gebiet beschäftigt, ist es immer wieder notwendig, diese Nabelschnur nicht ganz durchzuschneiden. Eine Verbindung zur Realität, oder sagen wir pauschal und einfach: zu unserer Erde, muss irgendwie schon noch da sein. Sonst würden wir dann wirklich vielleicht zu dem werden, als was wir manchmal ein bisschen apostrophiert werden: .weltfremde Spinner'."
Wolfgang Kummer berichtet von einer Begebenheit, in deren Zentrum ein ebenfalls ungenannt bleiben wollender Kollege steht. Er soll sich bei seinem Hausarzt beklagt haben: „Herr Doktor, mir tun die Knie weh ... und der Rücken ... Ich hab solche Kopfschmerzen, der Hals ist ganz schief und ich hab ununterbrochen Kopfweh ... meine Verdauung funktioniert nicht... und mir selber geht's auch gar nicht gut."
Die folgende Geschichte, in der es um die kleine Schwäche durchaus begründeter Eitelkeit geht, rankt sich um eine historisch höchst bedeutsame wissenschaftliche Persönlichkeit, die bereits alle in Frage kommenden Titel besaß und auch recht stolz darauf war. Erzählt wird dieses höchst charakteristische Geschichtchen von Wolfgang Kerber und seinem ehemaligen Kollegen Erich Nezbeda, wobei es den beiden im Interview um eine ganz besonders präzise Darstellung des historischen Sachverhalts ging: Kerber: „Richard Meister war natürlich Doktor... er war Universitätsprofessor..." Nezbeda: „Nein. Der Professor Meister war Präsident der Akademie der Wissenschaften. Er war Rektor und gleichzeitig Dekan!" Kerber: „Er war Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1945 bis 1951 und Präsident eben der selben Akademie. Sein Wunsch war es, als .Präsident' angesprochen zu werden. Einmal ist es passiert, dass er bei einer Prüfung von einer Studentin angesprochen wurde, und wie sich die Studentin erdreistet hat, zu Richard Meister ,Grüß Gott, Herr Professor!' zu sagen, da hat Meister äußerst unwirsch reagiert: ,Na, sagen S' das nächste Mal vielleicht gleich .Richard' zu mir!'"
Zurück zur angeblichen Weltfremdheit, die seitens der Wissenschaftler oft genug geleugnet wird. Edmund Hlawka belegt den Umstand einer gewissen „Erdenferne" vieler seiner Fachkollegen mit einer Anekdote, in deren Zentrum zunächst ein Papagei steht und dann der berühmte Mathematiker David Hubert: „Es hat einen großen österreichischen Mathematiker gegeben, Herglotz, der zum Schluss Professor in Göttingen war, und noch einen zweiten Mathematiker, den ich nennen muss, Hans Hahn, der auch zu den größten österreichischen Mathematikern zählte, der zunächst in Czernowitz war, dann in Bonn und dann in Wien. Die beiden waren eingeladen und hatten ein Stipendium von Wien aus nach Göttingen. Sie waren also bei Hubert eingeladen. Hans Hahn hat gerne Witze erzählt, um irgendetwas zur Unterhaltung beizutragen. Da erzählt er den Witz: ,Ein Papagei ist entkommen aus einer Wohnung und sitzt auf einem Baum. Der Bauer, dem der Grund und der Baum darauf gehört, denkt sich, den hole ich mir runter, der ist so schön bunt. Er legt eine Leiter an, klettert empor und will nach dem Vogel greifen, da sagt der Vogel: Sie wünschen!? Da sagt der Bauer: Entschuldigen schon, ich habe geglaubt, Sie sind ein Vogel. Er klettert zurück.' Jetzt wartet Hans Hahn auf das Lächeln vom Hubert. Hubert schweigt und sagt nach einer Weile: ,Aber es war doch ein Vogel!' Hans Hahn und auch Herglotz wollten in den Boden versinken, Hubert hat geschwiegen, der Witz ist total danebengegangen. Das hat mir Herglotz persönlich erzählt." Nun stellt sich uns die entscheidende Frage. Der Logistiker Gurt Christian formuliert sie in knapper Form: „Warum hat Hubert nicht gelacht? Offenbar hat er, der ja vermutlich in andere Bereiche ,abkonzentriert' war, die Rede nur peripher mit bekommen und garnicht das Witzhafte gesehen. Es ist natürlich so. Man müsste hier diskutieren: Welche Form der Intelligenz? Man findet es ja sehr oft bei Leuten, die eine hohe abstrakte Intelligenz haben, dass sie dann im realen Bereich, wozu offenbar eine andere Form der Intelligenz nötig ist, versagen. Das gibt es, nicht wahr."
Hilbert war aber übrigens keineswegs der einzige berühmte zerstreute Professor. Wolfgang Kerber berichtet über einen berühmten Fachkollegen: „Von Ludwig Boltzmann wird erzählt - er war ja ein bedeutender Professor, der aber sehr stark wissenschaftlich orientiert war - , und da wird eben erzählt, dass er eines Tages bei einer Promotion, bei der er als Promotor fungierte, also als derjenige, der die Promotion durchführt, bereits wieder so in die Gedankenwelt seiner Probleme versunken war, dass er irrtümlich den Rektor zum Doktor promovieren wollte." Das ist nur einer von vielen Fällen, in denen die Präzision des Denkens zwar grundsätzlich perfekt funktionierte, aber wegen des Zerstreuungseffektes nicht in dem aktuell gefragten Seinsbereich. Das Phänomen des „Ab-Konzentriertseins" bedeutet hier also, dass die Konzentration, die Bündelung der Gedanken, nicht auf den aktuellen springenden Punkt gerichtet ist, sondern irgendwo daneben auf einen anderen. Die in gewissem Sinn ideale Welt der theoretischen Physik, die weder links noch rechts und schon gar keine Notwendigkeit des Abbiegens (Pauli!) kennt, ist, so gesehen, der realen Welt überlegen.
Noch idealer geht es in den noch weit abstrakteren Welten der Mathematik und Logik zu, wie Curt Christian zu erklären versucht: „Die so genannte .ideale Welt', also die Welt der Gedanken, die Welt der theoretischen Physik und der mathematischen Gegenstände, hat ihre Eigengesetzlichkeit und ihre Eigendynamik. Diese Welt ist von solch gewaltiger Schönheit, dass man gern die reale Welt, der man sich leider nicht ganz entziehen kann, verlässt und einen Ausflug in die ,ideale Welt' macht."