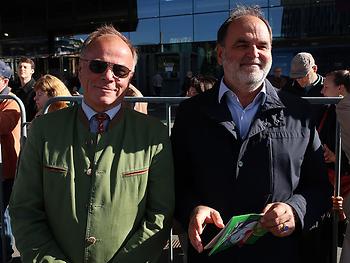In Bewegung bleiben#
(Die Museumsstraße der Mobiltätsmuseen)#
von Martin KruscheAuf der Grazer Herbstmesse gab es 2018 erstmals eine „Museumsstraße“, die von vier heimischen Museen gemeinsam bespielt wurde, um einen Eindruck von wesentlichen Momenten der steirischen Mobilitätsgeschichte zu vermitteln. Eine Geschichte der Fülle. Wir leben seit rund 200 Jahren in einer permanenten technischen Revolution. Es hat eine kontrastreiche Mischung von vorzüglichen Handwerkern, einfallsreichen Ingenieuren und tüchtigen Geschäftsleuten gebraucht, um während dieser 200 Jahre aus dem einstmals völlig rückständigen Land eine Region zu machen, in der schon mehrfach Technologie- und Sozialgeschichte geschrieben wurde, so auch Kulturgeschichte.
Zwischen diesen Menschen der Praxis waren freilich auch einige Machtpromotoren nötig, ebenso bewegliche Geister, die sich dem zuwandten, was in ihrer Gegenwart noch nicht deutlich gedacht werden konnte. Solcher Teil von Entwicklungen ist mit „Vision“ wenig treffend beschrieben, denn die Zukunftsfähigkeit kommt nicht ohne weiteres aus Eingebungen, die vom Himmel fallen. Sie kommt vor allem daher, daß sich Menschen mit Leidenschaft auf längere Zeit in Themen und Aufgaben verstricken lassen.
Aus all dem erwuchs eine Mischung der Ideen und Umsetzungen, von denen die Steiermark bis heute profitiert. Im Foyer Nord der Grazer Stadthalle fanden zu diesem Thema engagierte Menschen aus dem Grazer Tramway Museum, aus dem Johann Puch Museum Graz, dem Montan- und Werksbahnmuseum und dem Österreichischen Luftfahrtmuseum Graz-Thalerhof zusammen. Es entstand ein feines Konvolut von Raritäten in der genannten „Museumsstraße“. Man könnte sagen, ein lockeres Mosaik, das noch verdichtet werden kann, wenn Sie sich ein wenig Zeit nehmen wollen. Lassen Sie mich dazu eine kleine Geschichte des größeren Zusammenhangs erzählen.
Mit den Exponaten dieser Kooperation läßt sich weit mehr als ein Jahrhundert technischer Entwicklung unserer individuellen Mobilität anschaulich machen, wie sie in Graz und in der Steiermark erprobt, etabliert wurde. Das meint genau jenen Zeitrahmen, in dem Eisenbahn, Pferde-Tramway und Fahrräder die Welt der Kutschen und Fuhrwerke radikal erweiterten. Mitten in diesen Prozeß polterten spätestens ab 1900 Motorräder und Autos. Erst noch zarte Voiturettes (Wägelchen), wie sie von Puch oder Laurin & Klement gebaut wurden, aber auch von englischen, französischen und deutschen Produzenten. Schnell entwickelten sich stattliche Automobile daraus. Auch in den Lüften entstand zügig ein Verkehrsaufkommen, anfangs belebt von Abenteurern wie den Renner-Buben oder von einem Profi wie dem Offizier Eduard Nittner, dem sich Johann Puch übrigens sehr verbunden gefühlt hat.
Die Eisenbahn erwies sich in all dem als Avantgarde beim Verändern von Kontinenten, beim Verwandeln der Welt. Die von James Watt optimierte Dampfmaschine ergänzte anfangs als stationäre Kraftquelle die Wasserräder unserer Betriebe oder bewährte sich als Pumpe in Bergwerken. Als Lokomobil wurde sie beweglich, also ortsunabhängig einsetzbar. Als Lokomotive wurde sie zu einem radikal neuen Typ des Kraftfahrzeugs. Das prominenteste Beispiel europäischer Geschichte: der Artillerietraktor von Nicholas Cugnot, 1769 in Paris vorgestellt, in jenem Jahr, als Watt sein Patent erhielt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden auch frühe Automobile und einige Motorräder mit Dampf angetrieben. Vor allem bekam aber die Schiffahrt dadurch den vermutlich radikalsten Innovationsschub, seit im Portugal der Renaissance die Karavellen entwickelt worden waren.
Dampfschiffe sind in Graz kein großes Thema, denn die spärlichen Versuche auf der Mur gingen mit wehenden Fahnen unter. Aber die Eisenbahnlinie, für die man in der „Mobilitätsstraße“ stellvertretend die kompakte Garnitur einer Werksbahn sehen durfte, hat große Bedeutung. Sie macht übrigens ein Stück Stadtentwicklung begreiflich. Erst konnten Massengüter nur auf dem Wasserweg transportiert werden, woran in Graz noch heute der Floßlendplatz erinnert, auch der Bezirk Lend, denn da wurde mit Wasserfahrzeugen „angelandet“. Dieses Terrain war zugleich ein Teil der sogenannten Murvorstadt mit einem von zwei Mühlgängen für die Wasserräder von Betrieben.
In diesem Stadtteil voller wichtiger Produktionsstätten begann die Erfolgsgeschichte von Johann Puch, hatte sich Fahrradproduzent Benedict Albl etabliert Dort gab es Quartiere für die zahlreichen Studenten der Universität und die erste Kaserne der Stadt, damit Soldaten nicht mehr privat einquartiert werden mußten. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen.
Der nächste Modernisierungsschritt erweiterte die Infrastruktur nach Westen, als Karl VI. (der Vater Maria Theresias) von Wien aus fünf Post- und Kommerzstraßen bauen ließ, um der Reichshauptstadt bessere Verkehrsverbindungen zu schaffen. In Graz erinnert die Alte Poststraße an eine dieser Strecken, welche Wien mit dem Hafen in Triest verband, weshalb man in der steirischen Landeshauptstadt auch noch eine Triesterstraße findet. (Diese Route führte einst mitten durch die Bezirke Lend und Gries.)
Der dritte Modernisierungsschritt nach Westen ergab sich dann aus der Eisenbahnstrecke von Wien über Mürzzuschlag nach Graz und schließlich Triest. Dabei galt die Überwindung des Semmering als bedeutende Ingenieursleistung, sowohl bezüglich Streckenführung als auch im Lokomotivenbau. (In dieser Sache war Carl Ritter von Ghega besonders exponiert.) Deshalb hieß der Hauptbahnhof früher Südbahnhof, war übrigens Ziel der ersten Straßenbahnstrecke von Graz.
Eine etwas weniger prominente Verkehrsverbindung, die sogenannte Ungarnstraße, führte über die Ries, vorbei an Gleisdorf, in den östlichen Teil des Reiches. (Da kann man noch den einen oder anderen Meilenstein entdecken.) Die Ries wurde im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts zu einer wichtigen Rennstrecke, wo nicht nur Altmeister Puch seine Autos und Motorräder werbewirksam einsetzte. (Der Rennsport lieferte stets wichtige Verkaufsargumente für die teuren Fahrzeuge.) Aber gehen wir in der Geschichte kurz einen Schritt zurück.
Das Ende des 19. Jahrhunderts ist die Zeit, in der Niederräder, wie wir sie noch heute kennen und benutzen, den Konstruktionstyp Hochrad endgültig ablösten. Aus gutem Grund. Die Highwheeler mit der Tretkurbel am Vorderrad waren sehr teure und gefährliche Fahrzeuge. Man konnte damit auf den schlechten Wegen leicht stürzen. Das gab oftmals Verletzte, manchmal sogar Tote mit eingeschlagenen Köpfen. Das Safety mit seinem niederen, stabilen Diamantrahmen, mit der extra gelagerten Tretkurbel, an welcher die Muskelkraft des Menschen aufs Hinterrad übertragen wird, setzte sich durch. Es war zwar lange noch ein kostspieliger Wertgegenstand, aber es revolutionierte die individuelle Mobilität. Und das nicht nur im Stadtgebiet. Männer und Frauen mit dem nötigen Kleingeld liebten es, über Land zu fahren. (Daraus entwickelte sich ein eigenes Segment der Volkskultur. Siehe dazu: „Fahrradkultur im Spiegel der Grazer Radfahrvereine 1882-1900“ von Hilde Harrer!)
Zu jener Zeit waren die Straßen in den Städten vor allem von Fuhrwerken und Straßenbahnen dominiert. Dazwischen Fußvolk aller Arten. Diese Straßen boten übrigens auch den Menschen generell und alltäglich Lebensraum, ganz wesentlich jenen, die billige und schlechte Quartiere hatten. Die Verkehrsdichte nahm allerdings ab der Verbreitung des Fahrrades rasant zu, die Zweiräder führten in dieses Gewusel ein völlig neues Tempo ein, waren schnell und fast lautlos. Schnell und leise, das ist im Straßenverkehr eine Problemquelle, die wir nun seit über einem Jahrhundert kennen, die inzwischen vielleicht durch E-Mobilität neue Dimensionen erlangt. Diese Verhältnisse wurden damals gründlich aufgemischt, als die „Autler“ begannen, sich auf den Verkehrsflächen breiter zu machen. Die Behörde war zum Beispiel bemüht, den Passanten das Zeitungslesen unterm Gehen abzugewöhnen, weil vor allem die Automobile häufig Menschen überfuhren. Aber manchmal schaffte es auch ein sportlicher Radfahrer auf eine Titelseite, weil er jemanden umgefahren hatte. Oder die „Velozipedisten“ verhedderten sich ineinander.
Fuhrwerke, Straßenbahnen, Fahrräder und Autos, dazwischen natürlich auch Motorräder... Im Jahr 1905 begann die Behörde, für Kraftfahrzeuge Nummernschilder auszugeben und die Besitzer zu registrieren, weil es immer öfter zu Konflikten und Kollisionen unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer gekommen war, an denen man vorzugsweise der Raserei die Schuld gab. Raserei war etwas, das sich damals meist noch unterhalb der 45 Km/h abspielte, mit dem Fahrrad sowieso, aber auch mit den Kraftfahrzeugen.
Etwa um 1910 endete die Ära der zarten Voiturettes mit ihren Ein- und Zweizylindermotoren als Hauptereignis des jungen Automobilismus’. Das zahlungskräftige Publikum wünschte und bekam stärkere Fahrzeuge. Vierzylindermotoren wurden schnell zum Standard. Außerdem setzte sich die Zweite Industrielle Revolution durch. Das bedeutet, neue Werkzeugmaschinen, Automaten und Halbautomaten, ermöglichten die preisgünstige Produktion höherer Stückzahlen der einzelnen Komponenten, Zahnräder, Wellen, was auch immer.
Die Milchmädchenrechnung besagt: Gehen die Anzahl produzierter Einheiten rauf, können die Preise runtergehen, was Verkaufszahlen und Profit günstig beeinflussen sollte. Doch es dauerte noch bis Anfang der 1960er Jahre, daß kompakte Autos in Kauf und Erhalt endlich so günstig wurden, um eine Volksmotorisierung möglich zu machen. Bis dahin blieben Fuhrwerke im Straßenbild erhalten. Wer in den 1950er Jahren zur Welt kam, konnte mindestens noch Bierwagen sehen, die von robusten Norikern gezogen wurden. Fahrräder waren nach dem Zweiten Weltkrieg zur Massenware geworden, leichter erschwinglich.
Außerdem hat Graz seit dem Jahr 1878 Straßenbahnlinien. Das begann eigentlich mit dem 20. April 1865, als bei der k. k. Statthalterei in Graz Post vom österreichischen Konsulat in Genf eintraf. Das Geschäftshaus C. Schaeck-Jaquet & Cie. erbat die „Ertheilung einer Consession zum Baue und Betriebe americanischer Pferdebahnen“ in Graz.
Die erste „Hauptlinie“ erhielt ihre Baubewilligung im August 1876. Sie verband den Südbahnhof (heute Hauptbahnhof) mit dem Geidorfplatz. Offene Planungsfragen, nötige Bewilligungen, allerhand Behördenkram, die Sorge um eine „Sonntagsentheiligung“, das gesamte Vorhaben war anstrengend, doch Herbert Wöber notierte in seiner Monographie zum Thema: „Die Bauarbeiten gingen ohne besondere Schwierigkeiten vor sich.“ Der Betrieb wurde am 8. Juni 1878 eröffnet.
Wie schon angedeutet, Mitte der 1880er Jahre setzten sich die Niederräder durch. Komfortable und schnelle Maschinchen, deren Tretkurbel per Kette oder Kardanwelle mit dem Hinterrad verbunden ist. Grazer Produzenten wie Benedict Albl oder Johann Puch entwickelten sich zu harten Konkurrenten und boten exzellente Fahrräder an. Damit konnte man den hochwertigen Produkten aus England und Frankreich was entgegenstellen. So ist etwa das bis heute geschätzte Waffenrad von Steyr und Puch ursprünglich ein Lizenzprodukt der Firma Swift aus dem britischen Coventry. Siehe dazu: „Markante Marke, marktgerecht“ (Was wurde aus den Puch-Radeln?)
Diese Entwicklung entfaltete sich also parallel zur Grazer Straßenbahngeschichte. Damit wurden nun auch breitere Bevölkerungskreise mobiler, was sicht natürlich auch wirtschaftlich ausdrückte, denn die Mobilität von Arbeitskräften spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber das dauerte seine Zeit. Straßenbahnfahren war anfangs recht teuer.
Über all diese Jahrzehnte blieb der „Hafermotor“ unverzichtbar. In der Landwirtschaft weiß man heute noch, daß Pferde als Arbeitstiere den gut gestellten Bauern vorbehalten waren. Bei einem großen Teil steirischer Landwirtschaften mußte man mit Ochsen fahren und umbauen (pflügen und eggen), viele Leute hatten sogar bloß Kühe zur Verfügung. Zwar gab es bei uns keine stärkeren Zugtiere als die Ochsen, doch sie sind sehr langsam. Was die Pferde weniger an Kraft hatten, machten sie mit ihrem Tempo mehr als wett. Auch die Erhaltungskosten setzten einen markanten Unterschied. Während Rinder als Wiederkäuer Gras (Heu) verwerten können, stehen Pferde in direkter Nahrungskonkurrenz zu den Menschen. (Gras mähen oder Getreide anbauen und ernten, wahlweise zukaufen, das hat eben ganz unterschiedliche ökonomische Konsequenzen.)
Im urbanen Leben blieben Ochsen als Zugtiere sicher die Ausnahmeerscheinung. Aber sie kamen da eben doch vor. Ein Beispiel. Manfred Hohn zeigt in seinem Buch „Eisenbahnen in Österreichs Krankenanstalten“ ein nicht datiertes historisches Foto von der „Bahn der steiermärkischen Landes-Irren-Heil- und Pflegeanstalt Feldhof“. Darauf sieht man einen Ochsen im Feldbahneinsatz. Der Autor mutmaßt, das Foto könne in der Zeit des Zweiten Weltkrieges oder unmittelbar danach entstanden sein.
Das Halten von exzellenten Zugtieren war also aufwendig. Gute Fahrzeuge gingen auch ins Geld. Mit dem Kauf einer erstklassigen Kutsche konnte sich seinerzeit ein Adeliger durchaus ruinieren. In bürgerlichen Kreisen und für erfolgreiche Bauern setzte ein leichtes und robustes Steirerwagerl zum Ausfahren ebenfalls hinreichende Mittel voraus. Dieses Fahrzeug ist übrigens kein bloß steirisches Phänomen, sondern war ein über Landesgrenzen hinaus verbreiteter Kutschentyp.
Carl Gustav Wrangel schrieb in seinem 1898 erschienen Buch „Das Luxus-Fuhrwerk“ (Stuttgart) unter anderem: „Wie leicht und praktisch die Kutschier-Phaëtons und Dog-Carts aber auch sein mögen, auf holperigen Waldwegen und im Gebirge wird sich der Sporting-Gentleman doch gerne eines niedrigeren, weniger eleganten Fuhrwerkes bedienen.“
Wir ahnen heute gar nicht mehr, wie unbequem zum Beispiel übliche Postwagen gewesen sind, wie anstrengend das Reisen mit Kutschen war. Deshalb lobte Wrangel am „Steirerwagen“, was sich heute fast 1:1 auf den geländegängigen Grazer Langläufer Puch G anwenden ließe:
„Grosse Leichtigkeit, vortreffliche Federn, geräumiger Sitzplatz, bequemes Aus- und Einsteigen, Platz für Gepäck, Wild, Futter u. s. w., ausserordentliche Wendbarkeit, sicherer Gang, eine nette, gefällige Form — das alles stempelt das Steirerwägelchen zu einem Gebirgsfuhrwerk, wie man es sich besser gar nicht wünschen kann.“ (Naja, leicht ist der Puch G mit seinen mehr als zwei Tonnen nicht gerade, aber das gleicht die Technik aus, kompensiert, was einem im Cockpit an Muskelkraft fehlen mag.)
Merkwürdig genug, daß sich dieser seit Ende der 1970er Jahre produzierte Allrad-Champion, ursprünglich als Militärfahrzeug konzipiert, längst auch als Stadtfahrzeug etabliert hat. Aber damit ist es wie einst mit Pferden, den Puch G muß man sich leisten können. Die Frage, was leistbar ist, durchzieht die gesamte Mobilitätsgeschichte, seit vor Jahrtausenden der leichte Streitwagen erfunden wurde. Im städtischen Leben bedeutete einst die Straßenbahn eine Mobilitätsrevolution für breite Kreise, denn weder Kutschen noch Fahrräder waren für die meisten Menschen erschwinglich, von den ab 1900 verstärkt auftauchenden Kraftfahrzeugen ganz zu schweigen.
Was man in den Metropolen erst als Pferdeomnibusse sehen konnte, wurde beizeiten motorisiert. Buslinien veränderten auch den Überlandverkehr. Mit dem Ersten Weltkrieg kam die LKW-Entwicklung aus naheliegenden Gründen enorm in Schwung. Davor hatte die Behörde eine Subventionierung von Lastwagen begonnen.
Das heißt, wenn Unternehmen einen vom Staat spezifizierten LKW-Typ kaufte und dazu die Vereinbarung akzeptierte, das Fahrzeug angemessen zu warten, schließlich für Manöver oder im Kriegsfall dem Militär zu übergeben, gab es finanzielle Unterstützung. Daher auch der Begriff „Subventionslastwagen“.
Außerdem hatten die Prinzipien der Massenfertigung schon früh zu ersten Standardisierungen und zur Entwicklung von Flottenfahrzeugen geführt. Das prominenteste österreichische Beispiel dafür ist der Postbus ET 13. Dieser Einheitstyp 1913 wurde aus den Komponenten verschiedener Hersteller gebaut. Die bedeutendsten Autofabriken des Landes lieferten standardisierte Teile, so auch die Grazer Puchwerke. Altmeister Johann Puch sollte diesen Kategoriensprung der Industrie allerdings nicht lange überleben. Dabei hatte er zu jener Zeit schon begonnen, sich intensiver mit Luftfahrzeugen zu beschäftigen.
Das Fliegen blieb anfangs natürlich einer Minderheit vorbehalten. Matthias Marschik erwähnt in seinem Buch „Flieger, grüss mir die Sonne…“, einer kleinen Kulturgeschichte der Luftfahrt, auf dem Weg zum Ersten Weltkrieg entstammten die Piloten erst einmal zu einem „Gutteil dem ‚gutbürgerlichen’ Lager und dem niederen Adel“. Das änderte sich allerdings. Marschik: „Im Laufe des Krieges war die militärische Fliegerei immer mehr zu einem Terrain junger Männer aus der Mittelklasse mit typischen Gesten und Lebensgewohnheiten geworden, unter denen besonders die Unsentimentalität und der Glaube an die technische Machbarkeit und die Vertrautheit mit dem mechanischen Fortschritt hervorstachen.“
Diese Entwicklung lieferte Piloten für die spätere Zivilluftfahrt und nahm im Zweiten Weltkrieg einen massiven Aufschwung. Der Pilot und der Rennfahrer blieben quer durch das 20. Jahrhundert äußerst populäre Heldenfiguren, verehrte Rollenvorbilder. Da wundert einen dann auch nicht mehr, daß man Zeichensysteme und Designs aus der Jagdfliegerei des Ersten Weltkriegs später im Motorsport fand und noch heute als Variationen im zivilen Straßenverkehr entdecken kann. Siehe dazu: „Lackierte Kampfhunde“ (Jagdgeschwader in Bodennähe und ihre Dekors)!
Sieht man alte Zeitschriften durch, kann man gar nicht übersehen, wie diese Motive, Haltungen und Zuschreibungen zwischen den verschiedenen Lagern hin- und herwandern. Heldenposen, schneidige Attitüden und schließlich Maschinenverliebtheit. Egal, ob auf dem Pferd, dem Fahrrad, dem Motorrad, mit dem Automobil oder per Flugzeug. Man brauchte freilich Schneid in diesen frühen Tagen der Maschinisierung unserer Mobilität. Schwere Fahrzeuge, unzuverlässige Reifen, deren Karkassen sich bei hoher Geschwindigkeit ablösen konnten, schlechte bis gar keine Bremsen, es gab viele Faktoren, die einem den Lebensfaden kappen konnten.
Was nun die Attitüde angeht, falls ein Besuch des Heeresgeschichtlichen Museums Wien vor Ihnen liegt, sehen Sie sich dort auf jeden Fall nach einem großen Gemälde von Ludwig Koch um. Es zeigt den Grazer Ulanen Maximilian Ritter von Rodakowski in der Schlacht von Custozza. Rodakowski reitet im gestreckten Galopp frontal auf einen zu, den schweren Kavalleriesäbel hoch über dem Haupt schwingend. Das Bild gibt einen klaren Eindruck, von welchen Motiven ich hier eben erzählt hab. Auch wenn die Waffengattung Kavallerie mit der Mechanisierung des Großen Krieges erledigt war, die Pose ist geradezu zeitlos und drückt etwas aus, was wir im Straßenverkehr bis in die Gegenwart entdecken können.
Aber zurück zu zivileren Zusammenhängen. Das Glühen, Holzen, Brettern, die Selbstdarstellung als verflixter Kerl mit seinem gefährlichen, weil schnellen Auto, solche Genre-Bilder werden natürlich allemal gelebt und führen gelegentlich ins Gefängnis oder auf den Friedhof. Es ist zugleich Folklore und unbestreitbar Teil einer Volkskultur in der technischen Welt. Damit werden sich eventuell Ethnologie und Soziologie befassen. Doch wer einen Klassiker mühsam restauriert hat, will ihn nicht hinterher durch eitle Anwandlungen in die Tonne treten. Das gilt für viele Teilbereiche des Genres.
Alte Technik ist meist gefährdet, wenn sie wieder eingesetzt wird. Mit einem Puch Alpenwagen aus der Zwischenkriegszeit können Sie im heutigen Stadtverkehr eventuell verzweifeln, weil der Motor im Stop and Go thermische Probleme beäme und die Bremsanlage eventuell überfordert wäre. Um alte Lokomotiven bewegen zu können, brauchen Sie ausreichende Gleisanlagen, die viel Arbeit machen. Wer zum Beispiel verfolgt hat, wie der beeindruckend Pischof Autoplan (1909/1910) von Enthusiasten nachgebaut wurde, hätte weinen können, als das Fluggerät zweimal per Notlandung vom Himmel kam, dabei jeweils erheblich beschädigt wurde, um schließlich von der Austro-Control gesperrt zu werden.
Damit möchte ich das Augenmerk nun auf jene Aspekte lenken, die in den genannten Museen eine wesentliche Rolle spielen. Des Grazer Tramway Museum, das Johann Puch Museum Graz, des Montan- und Werksbahnmuseum sowie das Österreichische Luftfahrtmuseum Graz-Thalerhof gibt es, weil erfahrene Menschen ihre Leidenschaft mit Besonnenheit und Handfertigkeit verknüpft haben. Ohne diese Kompetenzen und viel privates Engagement wäre ein Großteil solcher Museumsbestände verloren, weil der Staat allein nicht leisten kann, was diese Gruppen über Jahre tun.
Mit Fahrzeugen aller Art ist es wie mit alten Musikinstrumenten. Stellt man sie bloß in Vitrinen, gehen sie allein dadurch kaputt. Man muß die Stradivaris und Amatis spielen, damit sie uns erhalten bleiben. Man muß die Fahrzeuge fahren, damit sie uns erhalten bleiben. Das setzt aber voraus, daß sie instand gesetzt werden, denn viele Juwelen dieser Genres waren vielleicht über Jahrzehnten in irgendwelchen Schuppen abgestellt, manche sogar dem Wetter ausgesetzt. Oft fehlen Teile. Viele Details sind nicht dokumentiert oder die Dokumente wurden verloren. Und menschliches Wissen ist äußerst kurzlebig.
Um also alte Fahrzeuge und Flugzeuge zu restaurieren, ist meist großer Aufwand nötig. Die Suche nach Informationen, nach Wissen und nach Teilen kann mitunter Jahre in Anspruch nehmen. (Beachten Sie bitte, eine Information zu haben bedeutet noch nicht, über Wissen zu verfügen, wie diese Information verwendet werden kann.) Wer sich solchen Aufgaben verschreibt, entwickelt meist eine Neugier für andere Wissensgebiete einer bestimmten Ära, ist mitunter sogar darauf angewiesen, eine ganze Epoche genauer zu erkunden, um verlorenes Wissen rekonstruieren zu können. Man muß eine Vorstellung gewinnen, wie damals gedacht und gearbeitet wurde. Dazu kommt, daß viele handwerkliche Kompetenzen, die eine Restauration verlangt, in heutigen Betrieben nicht mehr verfügbar sind, weshalb junge Leute nicht mehr wissen, wie man dies oder das macht, herstellt.
Was diese Szene also leistet, ist eine anspruchsvolle Wissens- und Kulturarbeit. Wo aber manche Details am Originalfahrzeug und seinen Zusammenhängen nicht mehr erhoben werden können, geht der versierte Schrauber daran, andere Fahrzeuge jener Ära zu untersuchen, um eine Annahme zu entwickeln, wie man ein bestimmtes Problem damals gelöst haben dürfte. Im Englischen nennt man das Reverse Engineering, was ungefähr meint, etwas auf alte Art neu erfinden, indem man die Prinzipien erhaltener Artefakte untersucht und anwendet.
Keines der genannten Museen könnte über Jahrzehnten bestehen, ohne sich auf inspirierte Menschen zu stützen, die dazu in der Lage sind. Das bedeutet ferner, daß auf solche Art Denk- und Arbeitsweisen erhalten bleiben, die ja auch grundsätzliche Qualitäten haben, nicht nur zeitbezogene Bedeutung. Damit will ich sagen, in diesem Engagement geht es nicht nur um den Erhalt alter Gegenstände, sondern auch menschlicher Fertigkeiten, die ganz unabhängig von den alten Artefakten für unsere Zukunft wichtig sein könnten.
Wissenschafter Hermann Maurer hat zu solchen Fragen einmal betont, wir Menschen hätten viel zu wenig Phantasie, unserem Talent zur Prophetie sei nicht zu trauen. Maurer: „Vieles, was vorhergesagt wurde, ist nicht gekommen. Dafür ist vieles gekommen, was niemand vorhergesehen hat.“ Das legt vielleicht nahe, erworbene Qualitäten nicht leichtfertig aufzugeben, bloß weil sie derzeit in der Wirtschaft nicht gebraucht würden.
Wovon hier die Rede ist, sollte daher nicht als eine Art rückwärtsgewandter Kulturarbeit unterschätzt werden. Wir leben heute in der Vierten Industriellen Revolution. Diese Ära ist davon geprägt, daß neue, EDV-gestützte Maschinensysteme sehr rasant viele jener Arbeitsbereiche übernehmen, die bisher den Menschen vorbehalten waren. Davor hatten wir schon in der Dritten Industriellen, der Digitalen Revolution, erlebt, daß wir menschliche Fertigkeiten einbüßen, wenn wir Dinge und Prozesse nicht mehr ohne weiteres begreifen, also auch mit den Händen angreifen können.
Diese Einbuße an Greifbarem in der Digitalisierung schreitet rasant voran. Zugleich werden Maschinen sprunghaft schlauer, entfalten sich selbstlernende Systeme, die uns Menschen aus allerhand Arbeitbereichen verdrängen. Wenn aber die Wirtschaft viele Kompetenzen von uns Menschen nicht mehr braucht, weil sie von Maschinen günstiger angeboten werden, was machen wir dann mit unserem Bedürfnis nach dem Begreifen? Wo üben wir das Handhaben von Dingen und das Erkunden komplexer Funktionen? Die sind schließlich nicht bloß für das Produzieren unserer Güter wichtig, sondern auch als Quelle so mancher Fertigkeiten des Menschen, die in Gemeinschaft unverzichtbar bleiben. Und genau darin brauchen wir so manches Können eventuell nicht bloß im Berufsleben, sondern genauso für private Belange.
Damit möchte ich deutlich machen, daß diese kleinen technischen Museen derzeit wichtige Umschlagplätze für Wissen und praktische Fähigkeiten sind, deren Erhalt und Weitergabe von der Wirtschaft aufgegeben wurden, während wir als Gesellschaft noch gar nicht klären konnten, was davon wir (ganz unabhängig von rein wirtschaftlichen Belangen) für menschliche Gemeinschaft auch weiterhin dringend brauchen.
Da sind Zusammenhänge, die wir in einer Volkskultur der technischen Welt derzeit noch gepflegt und verwahrt sehen; nicht als museale Güter in einem Depot, sondern als gelebte Praxis. Das hat übrigens auch einige Bezugspunkte in der Gegenwartskunst, so sich Kunstschaffenden aus ganz anderen Motiven mit solchen Überlegungen und Aufgaben befassen.
Bei all dem, wofür die vier Museen stehen, kommt überdies ein interessanter kulturpolitischer Aspekt zur Wirkung. Weder ist der Staat bloß eine Serviceeinrichtung für seine Bürgerinnen und Bürger, noch ist Volkswirtschaft mit Hauswirtschaft zu vergleichen. Andrerseits ist es nicht Zweck der Zivilgesellschaft, den Staat mit Ressourcen zu versorgen. Idealtypisch werden die drei Sektoren Staat, Markt und Zivilgesellschaft kooperieren, damit das Gemeinwesen gedeiht. Das muß stets neu entworfen, verhandelt und praktisch geübt werden. Politik und Verwaltung, die Wirtschaftstreibenden sowie Privatpersonen und gemeinnützige Vereine finden in solchen Prozesse gemeinsame Aufgaben, für deren Erledigung sie mit ihren Mitteln und Möglichkeiten zusammenarbeiten.
Das ist mit der Kooperation der drei Sektoren gemeint. Das handelt überdies von einer Kombination der verschiedenen Möglichkeiten, die eine Kombination von Hauptamt und Ehrenamt einbringt. Wer die Praxis kennt, weiß, wie knifflig es ist, bezahlte und unbezahlte Kräfte gemeinsam zur Wirkung zu bringen. Aber nur so sind manche Projekte überhaupt lebensfähig. Eine interessante Herausforderung, die sich stets neu stellt.
Weiterführend#
- Industrielle Revolutionen (Ein kleiner Überblick)
- Tempo und Maschinen (Weltgeschichte berührt Regionalgeschichte)
- Vom Steirerwagerl zum Puch G (Fahren, fahren, fahren in steirischer Prägung)
- Kulturwandel durch Technik (Textsammlung)
- Wir haben zu wenig Phantasie
Die Museen#
- Grazer Tramway Museum
- Johann Puch Museum Graz
- Montan- und Werksbahnmuseum Graz
- Österreichische Luftfahrtmuseum Graz-Thalerhof
- Dokumentation: Die Museumsstraße 2018